Die Angaben in den folgenden Kommentaren werden mit einem entsprechenden Hinweis (z.B. "Terminänderung" oder "Raumänderung") jeweils aktualisiert, falls sich Änderungen ergeben.
Lehrveranstaltungen, für die noch keine Kommentare erstellt wurden, werden nicht aufgeführt. Sie werden ergänzt, wenn die Kommentare vorliegen.
Vorlesung
in Alter Geschichte
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Zeit
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 120
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
27.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
H 4 (Raumänderung!)
Die Vorlesung plant für einen Zeitraum von der späten Republik bis etwa zum Ende des 3. Jh. n.Chr. die Entwicklungen auf den wichtigsten Feldern der römischen Sozial- und Wirt-schaftsgeschichte darzustellen. Besonderer Wert soll auf die Vorstellung der aktuellen Forschungstrends gelegt werden.
Literatur:
Demnächst im Netz abrufbar.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
01.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
01.2 - 08.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Die Zeit Diokletians
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 121
Zeit:
Mi 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
28.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
H 2 (Raumänderung!)
Nach dem Ende der Reichskrise erlebte das Imperium Romanum unter der Regierung von Kaiser Diokletian (284-305) erstmals seit langer Zeit eine Periode der Stabilität. Die innerere Verfassung des Reiches hatte sich allerdings als Reaktion auf die Probleme der vorausgegangenen Periode grundlegend verändert. Ziel des Seminars ist es, zu untersuchen, wie der neue diokletianische Staat aufgebaut war und wie er sich von dem Staatswesen der hohen Kaiserzeit unterschied.
Literatur:
Demnächst im Netz abrufbar.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
01.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
01.2 - 08.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Die hellenistischen Staaten und Rom
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 131
Zeit:
Mo 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
ZH 1
Zu Beginn des 3. Jh. v.Chr. war Rom noch eine Stadt am Rande der griechischen Welt, 150 Jahre später dominierte die Weltmacht Rom die Welt der hellenistischen Staaten. Ziel dieses Seminars ist es, die Etappen dieses Weges nachzuzeichnen und auch das politische Instrumentarium der Machtausübung, das vom römischen Staat in dieser Zeit entwickelt wurde, genauer zu untersuchen.
Literatur:
Demnächst im Netz abrufbar.
Hinweise:
Teilnehmerzahl 25
Anmeldung:
Im Sekretariat PT 3.1.48
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 10.1 - 14.1
GES-M
08.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Die Severer und die Reichskrise
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 132
Zeit:
Di 14-16
Dauer:
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
27.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
PT 2.0.9
In der knappen Periode zwischen 193 und 284 n.Chr. musste sich das Imperium Romanum einer Vielzahl von innen- (Wirtschaft, Sozialstruktur, Militär) und außenpolitischen Herausforderungen (Invasionen an Rhein und Donau, Reich des Sasaniden) stellen, die das Erscheinungsbild des Reiches grundlegenend veränderten. In diesem Seminar sollen sowohl die Herausforderungen als auch die römischen Reaktionen und Lösungsmodelle genauer untersucht werden.
Literatur:
Demnächst im Netz abrufbar.
Anmeldung:
Im Sekretariat PT 3.1.48
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 10.1 - 14.1
GES-M
08.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Neuere Forschungen zur Alten Geschichte
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 142
Zeit:
Di 18-20
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
27.04.2010
Raum:
PT 3.1.49
In dieser Veranstaltung, die für Verfasser/innen von Abschlussarbeiten und Dissertationen gedacht ist, soll sowohl die Möglichkeit gegeben werden, die eigene Arbeit vorzustellen als auch neuere Forschungsergebnisse zu diskutieren.
Literatur:
Anmeldung:
Bei Herrn Prof. Herz
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Sklaverei im Imperium Romanum
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 157
Zeit:
Mo 11.00-12.30 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
W 112 (Raumänderung!)
Ein begleitendes Tutorium wird angeboten.
Die antike römische Gesellschaft basierte auf der Ausbeutung von Sklaven. Die Unfreien bildeten allerdings keine homogene soziale Schicht, sondern das Spektrum ihrer Tätigkeiten und damit ihrer Stellung reichte vom hochqualifizierten Arzt bis zum Sklaven in den Bergwerken des Imperiums.
Ziel des Seminars ist es, anhand literarischer, archäologischer und epigraphischer Überlieferung die Lebenswirklichkeit der Unfreien in der römischen Antike zu untersuchen und anhand dieses Themas in die Arbeitsweisen und Hilfsmittel der Alten Geschichte einzuführen. So sollen zunächst die wesentlichen Merkmale antiker Sklaverei analysiert werden, um anschließend zu klären, auf welche Weise eine Person in die Sklaverei geraten konnte und wie die Infrastruktur des Sklavenhandels funktionierte. Die verschiedenen Wirtschaftssektoren, in denen Sklaven arbeiteten, werden ebenso behandelt wie die rechtliche Stellung der Unfreien, ihre Lebens- und Familienverhältnisse sowie die Möglichkeiten ihrer Freilassung. Die immer wieder auftretenden Sklavenaufstände sollen hinsichtlich ihrer Ursachen und Ziele, aber auch Konsequenzen und Sanktionen untersucht werden.
Literatur:
Alföldy, G.: Antike Sklaverei. Widersprüche, Sonderformen, Grundstrukturen, Bamberg 1988 (Thyssen-Vorträge. Auseinandersetzungen mit der Antike 7); Eck, W., Heinrichs, J., (Hgg.): Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1993; Finley, M.I.: Die Sklaverei in der Antike. Geschichte und Probleme, 2. Aufl. Frankfurt / Main 1987;Herrmann-Otto, E.: Sklaverei und Freilassung in der griechisch-römischen Welt, Hildesheim [u.a.] 2009 (Studienbücher Antike 15); Schumacher, L.: Sklaverei in der Antike: Alltag und Schicksal der Unfreien, München 2001; Vogt, J.: Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung, Wiesbaden 1972 (Historia Einzelschriften 8); Wiedemann, T.: Slavery, Oxford 1987 (Greece and Rome. New Surveys in the Classics 19).
Hinweise:
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Klausur, Referat, wöchentliche Arbeitsaufträge, ggf. Sprachtest Latein
Das Zeitalter der Diadochen
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 157a
Zeit:
Di 8.30-10.00
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
ZH 1 (Raumänderung!)
Durch den frühen Tod Alexanders des Großen geriet sein in wenigen Jahren erobertes Reich ins Wanken. Sein unerwartetes Ableben bildete den Auftakt zu einem jahrzehntelangen Ringen der Freunde und Heerführer des Makedonenkönigs um die Herrschaft. Die Verwicklungen mit stets wechselnden Bündnissen und der Verlauf dieser Auseinandersetzungen, die letztlich in die Entstehung der hellenistischen Königreiche mündeten, werden im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.
Zugleich dient das Seminar der allgemeinen Einführung in die Arbeitsweisen und Methoden der Alten Geschichte.
Literatur:
Bosworth, Albert B.: The Legacy of Alexander. Politics, Warfare and Propaganda under the Successors, Oxford 2002; Erskine, Andrew (Hrsg.): A Companion to the Hellenistic World, Oxford 2003; Gehrke, Hans-Joachim: Geschichte des Hellenismus (OGG 1A), 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, München 2003; Meißner, Burkhard: Hellenismus, Darmstadt 2007; Walbank, Frank W.: Die hellenistische Welt, München 1983.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr). Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, Arbeitsaufträge, Klausur, Referat, Seminararbeit.
Arbeit und Leben im Imperium Romanum (1.-3. Jahrhundert n.Chr.)
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 158
Zeit:
Mo 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
ZH 1
Glücklich und zufrieden wird man oftmals erst, wenn man auf der Suche nach dem wahren Leben einen Blick über den eigenen Gartenzaun wirft. Dies mag jenen so ergehen, die sich näher mit der Arbeits- und Lebenswelt der Menschen im römischen Weltreich befassen. Dennoch gerät hierbei mit der sog. Zeit des Principats eine Epoche in den Focus, die -einzigartig für den Lauf der Weltgeschichte – den Menschen über viele Generationen hinweg die Segnungen des Römischen Friedens brachten. Unter welchen Bedingungen man lebte und arbeitete, von welchen Normen und Werten man sich leiten ließ und welche Freuden und Aussichten das Leben dem Einzelnen und der Gruppe im Imperium Romanum bot, soll in dieser Veranstaltung thematisiert werden.
Literatur:
H.-J. Drexhage u.a.: Die Wirtschaft des Römischen Reiches (1.-3. Jh.). Eine Einführung, Berlin 2002
M. Prell: Armut im Antiken Rom, Stuttgart 1997
H. Schneider: Geschichte der Arbeit. Vom Alten Ägypten bis zur Gegenwart, Frankf.a.M. 1987, 95-154
K.W. Weeber: Alltag in Rom. Das Leben in der Stadt,. Ein Lexikon, Düsseldorf/Zürich 2001.
Ders: Alltag in Rom. Landleben. Ein Lexikon, Düsseldorf/Zürich 2000
Hinweise:
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Referat/Klausur/Hausarbeit/regelmäßige Teilnahme
Alexander der Große
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 159
Zeit:
Di 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
ZH 1
Der Niedergang der griechischen Poliswelt im 4. Jh. v.Chr. und das Ausgreifen Alexanders d.Gr. in den Orient eröffneten eine neue Phase antiker Geschichte im östlichen Mittelmeerraum. Sie ist nicht nur von militärischen Erfolgen bislang unbekannter Dimension gekennzeichnet, sondern auch von einem intensiven Austausch zwischen West und Ost. Das Vorgehen Alexanders und die Maßnahmen, die er zur Konsolidierung seiner Herrschaft traf, sollen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen wie die Folgen seines Eroberungszuges für die Gesellschaften im östlichen Mittelmeerraum und in den Gebieten des ehemaligen persischen Weltreiches.
Literatur:
Barceló, P.: Alexander d.Gr., Darmstadt 2007
Bosworth, A.B.: The Reign of Alexander the Great, Cambridge 1988
Bosworth, A.B.: Alexander and the East, Oxford/New York 1996
Demandt, A.: Alexander d.Gr. Leben und Legende, München 2009
Gehrke, H.-J.: Geschichte des Hellenismus, München 2. Aufl. 1995
Seibert, J. Alexander der Große, München 1972 (EdF 10)
Hinweise:
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Referat/Klausur/Hausarbeit/regelmäßige Teilnahme
Das spätantike Rom (284-395 n.Chr.)
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 160
Zeit:
Di 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Nach einer Periode existenzieller Gefährdungen des römischen Weltreichs (sog. Soldatenkaiserzeit zw. 235-284 n.Chr.) erlebte das römische Weltreich unter den tatkräftigen Kaisern Diokletian und Konstantin eine Phase der Regeneration und Stabilisierung, die mit tiefgreifenden Veränderungen in Staat und Gesellschaft verbunden waren. Zugleich erfolgte nach harten Verfolgungen der Aufstieg des Christentums zur bestimmenden Religion und schließlich gegen Ende des 4. Jahrhunderts zur Staatsreligion. Ziel des Seminars ist es nicht nur die Herrschaft der beiden genannten Kaiser zu skizzieren, sondern darüber hinaus das weitere Schicksal des Reiches bis zum Tode des Theodosius I (395 n.Chr.), der zum letzten Mal die Alleinherrschaft erringen konnte, zu skizzieren.
Literatur:
Brandt, H.: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der konstantinischen Dynastie (284-363), Berlin 1998
Demandt, A.: Die Spätantike, München 2. Aufl. 2007
Kuhoff, W.: Diokletian und die Epoche der Tetrarchie. Das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284-313 n.Chr.), Frankfurt/M 1999.
Potter, D.S.: The Roman Empire at bay. AD 180–395, London 2007
Hinweise:
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Referat/Klausur/Hausarbeit/regelmäßige Teilnahme
Die römische Gladiatur im Experiment
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 160a
Zeit:
Do 16-18 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
Sportzentrum, Besprechungszimmer (Raum Nr. 4006) (Raumänderung!)
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Wesen der römischen Gladiatur unter besonderer Berücksichtung der epigraphischen und der literarischen Zeugnisse behandelt. Zugleich fließen die Erkenntnisse aus einem interdisziplinären Experiment ein. Zwingend vorausgesetzt wird die Lektüre des Standardtitels von Marcus Junkelmann.
Literatur:
Marcus Junkelmann, Gladiatoren. Das Spiel mit dem Tod, 2.Aufl., Mainz 2008.
Anmeldung:
Ausschließlich persönliche Anmeldung
Modul/e:
GES-LA-M
01.1
GES-M
01.1
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Referat, Klausur, Seminararbeit
Übungen
in Alter
Geschichte
Die Flavier in den Kaiserbiographien Suetons
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 178
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ZH 1
Caius Suetonius Tranquillus (* 70 n.Chr.), hoher Verwaltungs- und Fachbeamter der Kaiser Trajan und Hadrian, ist der Nachwelt vor allem durch seine Kaiserbiographien, die vitae Caesarum, bekannt. Obwohl die Länge der einzelnen Biographien variert und zumeist einem stereotypen Schema folgen und die Darstellungen auf Unterhaltung ausgelegt sind, erweisen sie sich als wertvolle Quellen zur Geschichte der frühen Kaiserzeit. Einblicke hierin sollen die ausführlichen Lebensbeschreibungen der Vertreter der Flavischen Dynastie (i.e. Vespasian, Titus, Domitian) liefern.
Literatur:
Bengtson, H.: Die Flavier, München 1979
Max Heinemann (Übers.): Sueton: Cäsarenleben, Leipzig-Stuttgart 1936, 8. Aufl. 2001
Levick, B.: Vespasian, London/New York 1999
Pfeifer, St.: Die Zeit der Flavier, Darmstadt 2009
Hinweise:
Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 10.2
GES-M
08.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat/Klausur/regelmäßige Teilnahme
Erprobung der Navis Lusoria (in Kooperation mit dem Sportzentrum Universität Regensburg)
Veranstaltungstyp:
Übung - Projektübung - Übung mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 179
Zeit:
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
Raum:
wird noch bekanntgegeben
Seit Anfang März 2010 laufen die Überholungsarbeiten an der Navis Lusoria, i.e. dem spätantiken römischen Flusskriegsschiff der Universität Regensburg. Im Sommer sollen nun – zunächst im Hörsaal, dann auf dem Boot bzw. am Bootssteg – theoretische und praktische Übungseinheiten folgen. Insbesondere steht diesmal die Erprobung der neuen Riemenanordnung im Vordergrund. Mit dieser Übung wird auch eine mehrtägige Exkursion im September 2010 verbunden sein.
Literatur:
Hinweise:
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 10.2 - 14.3 - 15.5
GES-M
08.3 - 05.4 - 07.4 - 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Wie trainierte Spartacus? Ein interdisziplinäres Experiment zur sportlichen Ausbildung und Ernährung römischer Gladiatoren.
Veranstaltungstyp:
Übung - experimentell-archäologische Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 179a
Zeit:
Dauer:
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
Sportzentrum, wird bekannt gegeben
Im Rahmen dieser interdisziplinären Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaften die sportliche Ausbildung und das Training römischer Gladiatoren untersucht.
Literatur:
Marcus Junkelmann, Gladiatoren. Das Spiel mit dem Tod, 2. Aufl., Mainz 2008; Österreichisches Archäologisches Institut (Hg.), Tod am Nachmittag. Gladiatoren in Ephesos, Wien 2002.
Hinweise:
Teilnahme nur nach persönlicher Einladung
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Panem et circenses. Die Darstellung der römischen Circus-Spiele im Film.
Veranstaltungstyp:
Übung - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 179b
Zeit:
Di 18-20
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 2.0.5
Das Genre des "Sandalenfilms" hat unlängst eine ungeahnte Frischzellenkur erfahren. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Frage aufgeworfen, inwieweit das durch den Film erzeugte Bild die allgemeine Vorstellung von römischen Gladiatoren und Legionären prägt.
Literatur:
Marcus Junkelmann, Hollywoods Traum von Rom. "Gladiator" und die Tradition des Monumentalfilms, Mainz 2004.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 10.2
GES-M
08.3
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Referat, Klausur
Augustus
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 219
Zeit:
Mo-Fr 9-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung: 12.-16.4.2010
Beginn:
12.4.2010
Raum:
Montag, 12.4.2010 in H 7; Dienstag bis Freitag 13.4.-16.4.2010 in H 9 (Raumänderung!)
Der Grundkurs hat das Ziel, die historischen Entwicklungen am Beginn der römischen Kaiserzeit überblicksartig zu beleuchten. Im Mittelpunkt steht dabei die Etablierung des sogenannten „Prinzipats“ als Staatsform und Herrschaftssystem durch Kaiser Augustus. Es soll aber nicht nur ein Einblick in die politische Geschichte gegeben werden. Vielmehr geht es um eine Gesamtschau des Imperium Romanum um die Zeitenwende. Der Grundkurs richtet sich sowohl an Studienanfänger als auch an Examenskandidaten.
Literatur:
Gehrke, H.J., Schneider, H. (Hgg.): Geschichte der Antike. Ein Studienbuch, Stuttgart 2000; Gehrke, H.J., Schneider, H., (Hgg.): Geschichte der Antike - Quellenband, Stuttgart 2007; Bellen, H.: Gründzüge der römischen Geschichte, Darmstadt 8. Aufl. 1982. [Neuausgabe in 3 Bänden, Bd.1, 2. Aufl. 1995, Bd.2 1998, Bd.3 2003]; Dahlheim, W.: Geschichte der römi-schen Kaiserzeit, München 2. Auflage 1989 (Oldenbourg Grundriss); Dahlheim, W.: Die griechisch-römische Antike, Bd. 2: Rom, Paderborn 2. Aufl. 1994; Jacques, F., Scheid: J., Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v.Chr. - 260 n.Chr. Band 1: Die Struktur des Reiches, Stuttgart, Leipzig 1998; Kienast, D.: Augustus. Prinzeps und Monarch, 4. bibliogr. aktual. und um ein Vorwort erg. Auflage, Darmstadt 2009 (WBG); Lacey, W.K.: Augustus and the Principate. The evolution of a system, Leeds 1996; Lepelley, C.: Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v.Chr. - 260 n.Chr. Band 2: Die Regionen des Reiches, München, Leipzig 2001.
Anmeldung:
Anmeldung nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
06.4 - 07.3 - 10.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
Leistungspunkte:
3
Leistungsanforderungen:
Klausur
Das Zeitalter der Flavier und der Adoptivkaiser (68-180 n.Chr.)
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 220
Zeit:
Mi 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ZH 1
Behandelt wird ein Zeitraum, in dem das römische Imperium die längste Zeit über fest gegründet eine Phase des Friedens und der inneren und äußeren Stärke erlebt. Tatkräftige Kaiser wie Vespasian, Trajan, Hadrian und M. Aurel prägen in dieser Zeit das System des Principats, dessen Funktionsweise, Vor- und Nachteile in der Veranstaltung ebenso behandelt werden sollen. Natürlich kommen auch die innen- und außenpolitischen Ereignisse, die die Herrschaft der in dieser Zeit regierenden principes prägten, nicht zu kurz.
Literatur:
Bowman, A.K. e.a. (Hgg.): The Cambridge Ancient History. XI. The High Empire. AD 70–192, Cambridge 2000
Christ, K.: Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 4. Aufl. 2002
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
06.4 - 07.3 - 10.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Klausur/regelmäßige Teilnahme
Vorlesungen
in Mittelalterlicher
Geschichte
Einführung in die Geschichte der Merowingerzeit
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 122
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.4.2010
Raum:
H 4
Die Vorlesung versucht, eine Einführung in die Übergangsperiode zwischen ausgehender Spätantike und beginnendem Frühmittelalter zu geben.
Literatur:
Geary, P.: Die Merowinger – Europa vor Karl dem Großen, München 1996; Scheibelreiter, G.: Die barbarische Gesellschaft – Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit (5.-8. Jahrh.), Darmstadt 1999; Hartmann, M.: Aufbruch ins Mittelalter – Die Zeit der Merowinger, Darmstadt 2003, Ewig, E.: Die Merowinger und das Frankenreich, 5. Auflage, Stuttgart 2006
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
02.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
02.2 - 09.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Ringvorlesung: Krieg im Mittelalter
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 123
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
28.4.2010
Raum:
H 2
Das Forum Mittelalter bietet auch in diesem Sommersemester wieder eine interdisziplinäre Ringvorlesung mit Beteiligung der verschiedenen mediävistischen Fachdisziplinen an. Aktuelle Hinweise und Materialien zu den einzelnen Sitzungen sind zu Semesterbeginn auf der Homepage des Forums Mittelalter zu finden (www.forum-mittelalter.de).
| 28.04. |
Hans-Henning Kortüm (Mittelalterliche Geschichte)
Mars im Mittelalter. Anmerkungen zu einem schwierigen Thema
|
| 05.05. |
Andreas Merkt (Kath. Theologie/Alte Kirchengeschichte)
Krieg und Gewalt bei Augustinus |
| 12.05. |
Ulrich G. Leinsle (Kath. Theologie/Phil.-Theol. Propädeutik)
Krieg und Frieden aus klösterlicher Sicht |
| 19.05. |
Martin Völkl (Mittelalterliche Geschichte)
Frömmigkeit, Ruhmsucht, Beutegier? Die Motivation der ersten
Kreuzfahrer |
| 02.06. |
Hans-Jürgen Becker (Rechtsgeschichte)
Krieg, Recht und Kirche im Mittelalter |
| 09.06. |
Albert Dietl (Kunstgeschichte)
Schlachtenglück und Sternenglaube. Der Freskensaal der Rocca von Angera und die Anfänge der Visconti-Signorie in Mailand |
| 16.06. |
Hans-Christoph Dittscheid (Kunstgeschichte)
Krieg auf Erden und am Himmel. Kriegsvisionen bei Albrecht Dürer und Albrecht Altdorfer |
| 23.06. |
Rolf Schönberger (Philosophiegeschichte)
Die Idee des Friedens und der Krieg der Prinzipien |
| 30.06. |
Martin Löhnig (Rechtsgeschichte)
Spätmittelalterliche Kriegsordnungen |
| 07.07. |
Alfons Knoll (Kath. Theologie/Fundamentaltheologie)
Krieg als Metapher in Theologie und Spiritualität |
| 14.07. |
Edith Feistner (Deutsche Philologie/Mediävistik)
‚Heiliger Krieg’ und deutsche Literatur des Mittelalters: Das Beispiel der literarischen Interessenbildung im deutschen Orden |
| 21.07. |
Martin Clauss (Mittelalterliche Geschichte)
Erzählen vom Krieg |
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
02.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
02.2 - 09.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst. Das Zeitalter des sogenannten Investiturstreits
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 123a
Zeit:
Do 16-18 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
H 2 (Raumänderung!)
Nimmt man die gut hundert Jahre vom Beginn des 11. bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts in den Blick, so fällt vor allem der grundlegende Wandel im Verhältnis der beiden mittelalterlichen Universalmächte, Kaisertum und Papsttum, auf: von einem einträchtigen Miteinander zu Beginn zu einem in seiner Schärfe kaum zu überbietenden Konflikt am Ende. Die Vorlesung zeichnet diese keineswegs gradlinige Entwicklung nach und diskutiert die dafür maßgeblichen Gründe. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, die politischen und vor allem die religiösen Hintergründe der Zeit (Trennung von Ost- und Westkirche, Ausbildung des römischen Zentralismus, Entstehung neuer Reformorden etc.) näher zu erläutern.
Literatur:
Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert (= Die Kirche in ihrer Geschichte II, F 1), Göttingen 1988. Weitere (Spezial-) Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
Anmeldung:
ist nicht erforderlich
Modul/e:
GES-LA-M
02.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
02.2 - 09.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Hauptseminare
in Mittelalterlicher
Geschichte
Gregor von Tours
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 133
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
27.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Die "Decem libri historiarum" des „Historikers“ Gregor von Tours (gest. nach 593), gehört zu den bedeutendsten Zeugnissen der frühen Merowingerzeit. Im Mittelpunkt des Seminars soll eine intensive Interpretation dieses Geschichtswerkes stehen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die genaue Kenntnis (in deutscher Übersetzung) der "Decem libri historiarum" und die Bereitschaft, sich auch auf den lateinischen Ursprungstext und andere vergleichbare Zeugnisse dieser Übergangszeit zwischen Antike und Mittelalter einzulassen.
Eine gewisse Vertrautheit der merowingischen Geschichte namentlich im 6. Jahrhundert und die Lektüre von M. Heinzelmann: Gregor von Tours, Darmstadt 1994, werden erwartet.
Literatur:
Siehe Vorlesung
Anmeldung:
Ab Do., 11.2.2010, im Sekretariat des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45, Frau Völcker).
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 11.1 - 14.1
GES-M
09.1
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Rituale und Kein Ende? Zum Stand der mediävistischen Forschung
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 135
Zeit:
Do 10-12 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PHY 9.1.09
Die Erforschung von Ritualen hat in der deutschen Mediävistik Konjunktur – und das schon seit vielen Jahrzehnten. Vor allem in der politischen und der Verfassungsgeschichte nehmen diese Forschungen einen solchen Raum ein, dass man unlängst von einem "mediävistischen Panritualismus" gesprochen hat. Dieser polemische Vorwurf soll Anlass sein, die bisherigen Forschungen zu bilanzieren. Wo spielen Rituale im frühen Mittelalter eine Rolle und welche sind es? In welchen Forschungstraditionen stehen die entsprechenden Arbeiten? Welche Interpretationsalternativen kommen in Betracht? Diese und viele andere Fragen sollen im Hauptseminar auf möglichst breiter Basis diskutiert werden.
Literatur:
HEINRICH FICHTENAU, Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts, München 1992 (zuerst 1984); GERD ALTHOFF, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Friede und Fehde, Darmstadt 1997; PETER DINZELBACHER, Warum weint der König? Eine Kritik des mediävistischen Panritualismus, Badenweiler 2009
Anmeldung:
ab sofort im Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45)
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 11.1 - 14.1
GES-M
09.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Lateinkenntnisse sind unbedingt erforderlich.
Oberseminar
in Mittelalterlicher
Geschichte
Oberseminar für Doktoranden, Magistranden und Bearbeiter von Zulassungsarbeiten
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 143
Zeit:
Mi 8-11
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
Termine nach Vereinbarung
Beginn:
Raum:
PT 3.1.46
Bearbeiter von Zulassungs- und Magisterarbeiten sowie von Dissertationen erhalten Gelegenheit, ihre Themen vorzustellen und sich ergebende Probleme in einem größeren Kreis zu erörtern.
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Proseminare
in Mittelalterlicher
Geschichte
Die Königin im Frühmittelalter
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 162
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
H 42 (erneute Raumänderung!)
Im Mittelpunkt des Proseminars stehen bekannte und herausragende Königinnen frühmittelalterlicher Reiche. So werden Regentinnen des Ost- und Westgotenreiches, des Burgunder-, Langobarden-, des Merowinger- und letztendlich des Karolingerreiches näher untersucht. Zur Zeit der Merowinger (481/82-751) beispielsweise gab es eine Reihe politisch aktiver und einflussreicher Königinnen, wie etwa die Burgunderin Chrodechilde, die Thüringerin Radegunde, die Westgotin Brunichilde oder die Angelsächsin Balthild. Unter den Karolingern gelangten Königinnen schließlich auch zur Kaiserwürde, wie etwa Angilberga durch die Heirat mit Ludwig II. (einem Urenkel Karls des Großen). Von ihren Zeitgenossen wurde sie jedoch – wohl zu unrecht – als ebenso habgierig wie herrschsüchtig verurteilt.
Das Proseminar soll eine vertiefte Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten der Mediävistik bieten. In Referaten werden vor allem die Aufgaben der Königin, ihre Stellung und Handlungsspielräume sowie das Verhältnis zum jeweiligen Ehemann herausgearbeitet.
Literatur:
Zur Einführung: Goetz, Hans-Werner: Frauen im frühen Mittelalter. Frauenbild und Frauenleben im Frankenreich, Weimar (u. a.) 1995; Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter (UTB, Bd. 1719), Stuttgart 3. Aufl. 2006; Hartmann, Martina: Die Königin im frühen Mittelalter, Stuttgart 2009.
Hinweise:
Maximale Teilnehmerzahl: 24
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45) ab Mittwoch, den 10.02.2010, 7.00 Uhr.
Modul/e:
GES-LA-M
02.1
GES-M
02.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit, Referat, Klausur, Hausarbeit
König Heinrich V. von England (1413-1422) und sein Kampf um die Krone Frankreichs
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 163
Zeit:
Mo 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Heinrich V. ist trotz seiner nur neunjährigen Herrschaft bis heute einer der berühmtesten, wie auch umstrittensten Könige des englischen Mittelalters. In seinem Bestreben, von seinen Vorgängern verlorene Positionen in Frankreich wiederzugewinnen, ja sogar die französische Königskrone zu erlangen, ließ er den später so genannten „Hundertjährigen Krieg“ wiederaufleben. Seinen Nachruhm begründete er mit seiner gleichermaßen erfolgreichen, wie brutalen Kriegführung, dabei vor allem mit der vernichtenden Niederlage, die er den Franzosen 1415 bei Azincourt zufügte. Dem modernen Publikum ist er jedoch vor allem durch Shakespeares berühmtes Bühnenstück „Henry V“ bekannt, das dann gerade 1944 – angesichts der Vorbereitung der alliierten Invasion in Frankreich – von Laurence Olivier verfilmt wurde. Das Proseminar wird den historischen Heinrich V. näher betrachten und dabei aufbauend auf den im Propädeutikum vermittelten Grundlagen eine vertiefte Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten bieten. Thematisch werden sich die Seminarteilnehmer zunächst mit der Etablierung der neuen englischen Königsdynastie der Lancaster seit 1399, wie auch mit Heinrichs Kämpfen in Wales und England, seinem Verhältnis zu der häretischen Reformbewegung der Lollarden und seinen Vorbereitungen für den Krieg in Frankreich auseinandersetzen. Daran anschließend soll die Kriegführung des englischen Herrschers auf dem Kontinent anhand der Schlacht von Azincourt, wie auch im Hinblick auf die Belagerungen von Harfleur, Caen, Rouen und Meaux genauer untersucht werden.
Literatur:
Allmand, Christopher: Henry V (English Monarchs), London 1992 (ND New Haven [u.a.] 1997); Curry, Anne: Agincourt. A New History, Stroud 2005; Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter (UTB, Bd. 1719), Stuttgart 3. Aufl. 2006; Seward, Desmond: Henry V as Warlord (Classic Military History), London 1987 (ND London [u.a.] 2001).
Hinweise:
Höchstteilnehmerzahl: 24.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung im Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45) ab Mittwoch, 10.02.2010.
Modul/e:
GES-LA-M
02.1
GES-M
02.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit, Referat, Klausur, Hausarbeit.
Otto der Große (936-973): Die Renaissance des Kaisertums im 10. Jahrhundert
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 164
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Die im ZDF ausgestrahlte 10-teilige Dokumentarserie „Die Deutschen“ lässt die deutsche Geschichte mit Otto dem Großen beginnen, der als „Urvater Deutschlands“ gedeutet wird. Unter ihm hätten sich die verschiedenen Stämme des Ostfrankenreiches nämlich erstmals als eine „Schicksalsgemeinschaft“ empfunden. Das politische Wirken Ottos I., der im Laufe seiner Herrschaft nicht nur ostfränkisch-deutscher König blieb, sondern auch zum langobardischen König und schließlich sogar zum römischen Kaiser avancierte, steht im Fokus dieses Proseminars. Dabei werden die im Propädeutikum erworbenen Grundlagen des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens vertieft, erweitert und am Beispiel der Beschäftigung mit Otto dem Großen praktisch umgesetzt. Thematisch soll unter anderem Ottos Herrschaftsidee erarbeitet werden, bei der er bestrebt war an karolingische Traditionen anzuknüpfen. Dabei ist nicht nur der Verlauf seiner Krönung, sondern vor allem auch sein Verhalten gegenüber den Großen des Reiches näher zu betrachten, das – neben anderen Ursachen – zu zwei bedrohlichen Aufständen führte. Erst nach der Niederschlagung der innenpolitischen Revolten, wie auch nach der vernichtenden Niederlage, die Otto 955 den Ungarn in der berühmten Lechfeldschlacht beigebracht hatte, war seine Herrschaft dauerhaft gefestigt. Neben den kriegerischen sollen auch seine politischen Erfolge untersucht werden, zu denen etwa der Erwerb der langobardischen Königskrone und die Kaiserkrönung zählen. Darüber hinaus ist nach Ottos Beziehungen zu anderen europäischen Mächten, wie etwa zu den Königen des Westfrankenreiches und zu den byzantinischen Kaisern zu fragen. Schließlich soll auch das von Otto dem Großen gegen zahlreiche Widrigkeiten langfristig verfolgte Projekt der Gründung des Erzbistums Magdeburg ausführlich behandelt werden.
Literatur:
Althoff, Gerd: Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat (Urban-Taschenbücher, Bd. 473), Stuttgart [u.a.] 2. Aufl. 2005; Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter (UTB, Bd. 1719), Stuttgart 3. Aufl. 2006; Laudage, Johannes: Otto der Große (912-973). Eine Biographie, Regensburg 2. Aufl. 2006.
Hinweise:
Höchstteilnehmerzahl: 24.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung im Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45) ab Mittwoch, 10.02.2010.
Modul/e:
GES-LA-M
02.1
GES-M
02.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit, Referat, Klausur, Hausarbeit.
Übungen
in Mittelalterlicher
Geschichte
Quellenlektüre zur Geschichte der Ottonen (919-1024)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 182
Zeit:
Di 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
CH 33.1.93 (Raumänderung!)
Nach dem Tod des ostfränkischen Königs Konrad I. (911-918) wurde im Jahre 919 der sächsische Herzog Heinrich zu seinem Nachfolger gewählt. Mit ihm begann die über hundert Jahre währende Herrschaft einer neuen Königsdynastie, die bereits mit Heinrichs Sohn Otto I. (936-973) neben der ostfränkisch-deutschen auch die langobardische Königskrone, wie auch die römische Kaiserwürde erlangte. Im Rahmen der Übung sollen durch die gemeinsame Lektüre zeitgenössischer historiographischer Werke – ergänzt durch die Analyse wichtiger Urkunden – ausgewählte Aspekte ottonischer Königs- und Kaiserherrschaft genauer untersucht werden. Im Einzelnen werden dabei der Beginn des ottonischen Königtums unter Heinrich I., die Organisation der deutschen Abwehrkämpfe gegen die Ungarn unter Heinrich und Otto I., die innenpolitischen Auseinandersetzungen und Aufstände während der Herrschaft Ottos I., seine Italienpolitik und Kaiserkrönung, die Gründung des Erzbistums Magdeburg, die außenpolitischen Beziehungen zum byzantinischen Kaiserreich, die militärischen Rückschläge gegenüber Muslimen und Slawen gegen Ende der Regierung Ottos II. (973-983), die Bedeutung Roms in der Kaiseridee Ottos III. (983-1002) und die Gründung des Bistums Bamberg durch Heinrich II. (1002-1024) nähere Betrachtung finden.
Literatur:
Althoff, Gerd: Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat
(Urban-Taschenbücher, Bd. 473), Stuttgart [u.a.] 2. Aufl. 2005;
Althoff, Gerd / Keller, Hagen: Die Zeit der späten Karolinger und der
Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888-1024 (Gebhardt. Handbuch der
deutschen Geschichte, Bd. 3), Stuttgart 10. Aufl. 2008; Beumann,
Helmut: Die Ottonen (Urban-Taschenbücher, Bd. 384), Stuttgart [u.a.] 5.
Aufl. 2000.
Hinweise:
Höchstteilnehmerzahl: 20.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung im Sekretariat für Mittelalterliche
Geschichte (PT 3.1.45) ab Mittwoch, 10.02.2010.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 11.2
GES-M
09.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit,
selbständige Vorbereitung und Analyse relevanter Quellen hinsichtlich
ausgewählter Fragestellungen, Moderation einer Seminarstunde;
gegebenenfalls Seminararbeit (nur dann, wenn die Veranstaltung als
hilfswissenschaftliche Übung oder als Übung zu Theorie und Methode der
Geschichtswissenschaft eingebracht werden soll).
Schriftkunde – lateinische und deutsche Paläographie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 183
Zeit:
Do 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
H 47 (erneute Raumänderung!)
Voraussetzung für historisches Arbeiten und Forschen an Originalquellen ist die Fähigkeit Handschriften lesen zu können. Die Übung beschäftigt sich mit Entwicklung und Form von Schriften vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit. Die Schriften von Kanzleien – so konservativ sie oft sind – und die Schriften des Alltags sind in verschiedenen Perioden Schrittmacher für die Schriften der Codices als auch der „pragmatischen Schriftlichkeit“. Die Schriftentwicklung wird anhand ausgewählter Quellen (Lex Baiuvariorum, Wormser Konkordat, Goldene Bulle u.a.) aufgezeigt und die Texte werden gemeinsam gelesen.
Literatur:
Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 24), 2. Aufl., Berlin 1986; Elke Frfr. von Boeselager, Schriftkunde (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften, Band 1), Hannover 2004; Heribert Sturm, Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stilformen, Neustadt an der Aisch 1961 (Neudruck 2005); Karl Löffler, Wolfgang Milde, Einführung in die Handschriftenkunde (Bibliothek des Buchwesens 11), Stuttgart 1997; Jacques Stiennon, Paléographie du Moyen Age, 3. Aufl., Paris 1999; Karin Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999; Adriano Capelli, Lexicon abbreviaturum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Mailand 1973 (Neudruck der 6. Aufl. von 1929).
Anmeldung:
Ab Mi., 10.2.2010, im Sekretariat des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45, Frau Völcker).
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 11.2
GES-M
09.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Leistungsnachweis erfolgt über Referat.
De viris illustribus. Geschichte einer Gattung von der Spätantike bis zum Hochmittelalter
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 180
Zeit:
Mi 18-20.30
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Unter dem Titel "De viris illustribus" ist seit der Spätantike eine Reihe von Texten erschienen, die man am ehesten als Literaturgeschichte, geordnet nach Verfassern, bezeichnen könnte. Die Tradition beginnt mit Hieronymus von Stridon und Gennadius von Marseille und reicht über Isidor von Sevilla bis zu Wolfger von Prüfening, dem sogenannten Anonymus Mellicensis (12. Jahrhundert). Im Zentrum der Veranstaltung steht die Lektüre, Übersetzung und Kommentierung dieser Texte, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Gattungstradition liegen soll.
Literatur:
Textausgaben: Hieronymus und Gennadius, Liber de viris illustribus, ed. ERNEST CUSHING RICHARDSON (= Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 14,1) Leipzig 1896; Isidorus Hispalensis episcopus, Liber de uiris illustribus, ed. CARMEN CODOÑER MERINO, El "de uiris illustribus" de Isidoro de Sevilla. Estudio y critica (= Theses et studia philologica Salamanticensia XII), Salamanca 1964; Anonymus Mellicensis, Catalogus virum illustrium, ed. EMIL ETTLINGER, Der sogenannte Anonymus Mellicensis De scriptoribus ecclesiasticis, Diss. phil. Straßburg 1896
Anmeldung:
ab sofort im Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45)
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 11.2
GES-M
09.3 - 05.1 - 07.1
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Lateinkenntnisse sind unbedingt erforderlich.
Grundkurs
in Mittelalterlicher
Geschichte
Repetitorium: Grundkurs Mittelalterliche Geschichte Teil I (von 500 - 1250 n. Chr.)
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 221
Zeit:
Mo 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.4.2010
Raum: H 7 (Raumänderung!)
Um einen klassisch gewordenen Filmtitel von Woddy Allen („Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten!“) abzuwandeln, will Ihnen das Repititorium bei der Beantwortung Ihres Wissensdurstes („Alles was Sie schon immer über das Mittelalter wissen wollten“) helfen.
Literatur:
Alle einschlägigen Handbücher. Zur Anschaffung empfohlen wird Hilsch Peter: Das Mittelalter – die Epoche, UTB Stuttgart, 2006
Anmeldung:
Ab Do., 11.2.2010, im Sekretariat des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45, Frau Völcker).
Modul/e:
GES-LA-M
06.4 - 07.3 - 11.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Vorlesungen
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Emanzipation, Partizipation und nationale Integration:
Die Verfassungsentwicklung in Deutschland vom Rheinbund
bis zur Bundesrepublik
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 124
Zeit:
Mi 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
28.4.2010
Raum:
H 8 (Raumänderung!)
Die Vorlesung verfolgt die Verfassungsentwicklung von den Anfängen des Frühkonstitutionalismus in den Rheinbundstaaten über die Herausbildung des Verfassungsmodells der konstitutionellen Monarchie im Deutschen Bund zu den gesamtstaatlichen Verfassungen von 1849 und 1871. Die deutsche Verfassungsgeschichte des 20. Jahrhunderts steht im Zeichen der Begründung der parlamentarischen Demokratien von 1919 und 1949 und ihrer Gefährdungen. Der Vorlesung liegt ein erweiterter Verfassungsbegriff zugrunde, der auch die informelle Parlamentarisierung des Kaiserreichs und die Entwicklung zum konsensfundierten Sozialstaat heutiger Prägung umschließt.
Literatur:
WILLOWEIT, D.: Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Ein Studienbuch, Teil 3 und 4, 6. Aufl., München 2009; BRANDT, P. u.a. (Hg.): Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Band 1: Um 1800, Kapitel 9, Bonn 2006; BOLDT, H.: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band I: Von den Anfängen bis zum Ende des älteren deutschen Reiches 1806, 3. Aufl., München 1994; Band II: Von 1806 bis zur Gegenwart, 2 Aufl., München 1993; DERS.: Von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen Demokratie, in: Wendemarken in der deutschen Verfassungsgeschichte (Der Staat, Beiheft 10, 1993, S. 151-186); BOTZENHART, M.: Deutsche Verfassungsgeschichte 1806-1949, Stuttgart u.a. 1993; FENSKE, H.: Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Norddeutschen Bund bis heute, 4. Aufl., Berlin 1993; GRIMM, D.: Deutsche Verfassungsgeschichte 1776-1866. Vom Beginn des modernen Verfassungsstaates bis zur Auflösung des Deutschen Bundes, 3. Aufl. Frankfurt a.M. 1995.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Klausur
Geschichte Südosteuropas: Von der osmanischen Eroberung bis zur Europäischen Integration
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 126
Zeit:
Di 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
H 16
Diese Vorlesung soll die Grundzüge der südosteuropäischen Geschichte in der Neuzeit vermitteln und in die wichtigsten Forschungsansätze einführen. Ziel ist es, einerseits die Besonderheiten der Geschichte dieses Raumes herauszuarbeiten, andererseits aber vergleichende Dimension deutlich zu machen. Dabei wird auch thematisiert, wie und ob „Südosteuropa“ als Geschichtsregion definiert werden kann.
In der Vorlesung wird es nicht nur um die politische Geschichte gehen, sondern auch um die sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen seit dem Beginn der osmanischen Herrschaft. Auch alltagsgeschichtliche Fragestellungen – wie die Rolle der Religion sowie die Formen von Familie und Verwandtschaft – werden nicht zu kurz kommen; die geografischen Grundlagen der Geschichte werden ebenfalls erläutert. Damit führt die Vorlesung auch in zentrale Fragestellungen der historischen Anthropologie und Sozialgeschichte ein – mit Beispielen aus Südosteuropa.
Der zeitliche Fokus liegt auf der Periode der osmanischen Herrschaft sowie der Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert, wobei insbesondere Fragen der Nationsbildung, der kommunistischen Herrschaft und der sozioökonomischen Transformation erörtert werden.
Ausführliche Informationen und Studienunterlagen werden zeitnah im G.R.I.P.S zur Verfügung gestellt.
Literatur:
Literaturangaben werden vor Semesterbeginn auf der E-Learning-Plattform bekanntgegeben.
Anmeldung:
keine Anmeldung erforderlich
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Klausur
Das östliche Europa im Zweiten Weltkrieg
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 127
Zeit:
Fr 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
H 22
Zweifelsohne ist der Zweite Weltkrieg für das östliche Europa von einschneidender Bedeutung gewesen. Die Vorlesung thematisiert daher die ideologischen Grundlagen des Vernichtungskrieges, befasst sich mit dem Kriegsgeschehen und der deutschen Besatzungspolitik, mit dem Holocaust wie mit Verbrechen der Wehrmacht. Zur Sprache kommen werden ferner die Reaktionen der Okkupierten sowie die Rolle der mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbündeten Staaten in Ostmittel- und Südosteuropa.
Literatur:
Das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg, herausgegeben im Auftrag des Militärhistorischen Forschungsamtes Potsdam, 10 Bände, Stuttgart 1979-2008.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: toensmeyert@aol.com
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Geschichte Ungarns vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 128
Zeit:
Mo 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
WIOS 017
Die Vorlesung arbeitet die Grundzüge der Geschichte Ungarns von der Staatsgründung um 1000 bis 1989 anhand der internationalen Fachliteratur heraus. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Strukturen im politisch-rechtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, die entweder periodisch oder epochenübergreifend prägend waren. Unter dem zweiten Leitaspekt der Nachbarschaftsbeziehungen und überregionalen Verbindungslinien wird auch der gesamteuropäische Deutungsrahmen aufgezeigt.
Literatur:
Literatur wird zum Semesterbeginn bekanntgegeben.
Anmeldung:
Anmeldung nicht erforderlich
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige und aktive Teilnahme
Israel/Palästina. Die Geschichte eines Landes, von 1882 bis zur Gegenwart
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 129
Zeit:
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung 29.6.-9.7.2010 von 18-20 Uhr
Beginn:
29.06.2010
Raum:
CH 33.0.87
Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten ist über 100 Jahre alt. In der Vorlesung werden die Gründe dieses Konflikts analysiert und die Rolle von Nationalismus und Kolonialismus in der „Geschichte eines Landes“ untersucht. Die zionistische Ideologie sowie die zionistische Siedlungspolitik vor der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 werden einer eingehenden Analyse unterzogen. Die „Nakba“ (die Vertreibung der Palästinenser), die Rolle des arabischen Nationalismus wie auch die Formierung einer palästinensischen Identität seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert werden intensiv diskutiert. Andere Themen der Vorlesung sind Ethnizität und Gender, Staat und Religion, Menschenrechte, Krieg und Gesellschaft sowie die erste Intifada. Im Kurs sollen auch Dokumentarfilme sowie Spielfilme zum besseren Verständnis gezeigt werden.
Literatur:
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: cp59@leicester.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Hauptseminare
in Neuerer und Neuester
Geschichte
200 Jahre Laboratorium Europas: Alt-Tirol von Innsbruck bis Trient zwischen Tradition und Moderne (1800-2000)
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 136
Zeit:
Di 16-18
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
20.04.2010 (Terminänderung!)
Raum:
PT 2.0.9
29. Juni - 6. Juli 2010 (Terminänderung!)
Projektbezogene Gruppenreferate (2-3 Studierende) fallweise vor Ort
Höchstteilnehmerzahl: ca. 20
Vom nördlichen Alpenrand bis an den Gardasee reicht eine Region, in deren historischen Grenzen sich auch nach der politischen Teilung 1919 europäische Geschichte wie unter einem Brennglas verdichtet: Enttraditionalisierung, Zwangsmodernisierung und restaurativer revival zwischen Napoleon und europäischen Revolutionen 1848/49; Konstitutionalisierung, katholische Rekonfessionalisierung und alldurchdringende Nationalisierung zweier großer Sprachgruppen bis 1914/1918; gewaltsame Integrationsversuche und totalitäre Entgrenzungen durch Faschismus und Nationalsozialismus (1919/22-1943/45); Autonomiekampf und Minderheitenschutz, europäische Integration und Globalisierung bis über die Schwelle des 21. Jahrhunderts hinaus. Gerade das zwischen zwei Kulturräumen stehende, einstmals schwer umkämpfte Südtirol scheint nach allen diesen dramatischen Einschnitten und schmerzhaften Verwerfungen heute ein Erfolgsmodell modern-bewahrender Vielfalt über Europa hinaus zu sein.
Die projektorientierte Lehrveranstaltung folgt der Annahme, daß sich diese Geschichte(n) am besten vor Ort erschließen (und erzählen) lassen – sei es durch den Augenschein von Denkmälern, ultramontanen Wallfahrtsorten, Andreas-Hofer-Filmen, Pionierprojekten des Alpin-Tourismus, faschistischen Stadtplanungsversuchen oder Gedächtnisorten des Irredentismus und des Südtiroler Autonomiekampfes. Diese innovative Konzeption will das Seminar als einwöchige Exkursion an verschiedenen Orten Südtirols und des Trentino (29. Juni - 6. Juli 2010) verwirklichen.
Literatur:
Vorab-Pflichtlektüre: einschlägige Seiten zum 19./20. Jh. bei
FORCHER, M.: Kleine Geschichte Tirols, Innsbruck 2006.
Ferner grundlegend: Geschichte und Region/Storia e Regione 9 (2000): Tirol-Trentino – Eine Begriffsgeschichte.
Aktueller Hinweis:
Das Hauptseminar ist voll belegt. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Kriegsopfer und Sozialpolitik nach den Weltkriegen (mit besonderer Berücksichtigung Osteuropas)
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 140a
Zeit:
Mi 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
H 37 (Vorklinikum Biologie) (Raumänderung!)
Schon 1983 beschrieb Michael Geyer in einem wegweisenden Aufsatz die Kriegsopferversorgung als "Vorboten des Wohlfahrtsstaates". Nach dem Ersten Weltkrieg waren sowohl die alten Staaten Westeuropas als auch die neu- und wieder entstehenden Staaten Osteuropas mit dem Problem der Versorgung der Kriegswitwen, -waisen und invaliden konfrontiert. Die Lösungsansätze folgten der Logik moderner Sozialpolitik und legten damit Grundlagen für die weitere Entwicklung. Dieser Zusammenhang ist mittlerweile nicht nur für die west-, sondern –in neuen Forschungen – auf für die osteuropäischen Länder gut nachvollziehbar. Wir werden uns in dem Seminar eingehend mit dem aufgezeigten Zusammenhang befassen und dabei den Blick auch auf die weitere Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg werfen.
Literatur:
Geyer, Michael, Ein Vorbote des Wohlfahrtsstaates. Die Kriegsopferversorgung in Frankreich, Deutschland und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg, in: GG 9, 1983, 230–277.
Cohen, Deborah, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914–1939. Berkeley/Los Angeles/London 1968.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per Email an: Natali.Stegmann@geschichte.uni-r.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Die Wiedervereinigung Deutschlands 1989/90
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 137
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
H 10 (Raumänderung!)
Die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 zählt zu den großen Zäsuren in der deutschen Politikgeschichte im 20. Jahrhundert. Die Wiedervereinigung war das Ergebnis internationaler sowie auch innergesellschaftlicher und innenpolitischer Entwicklungen, die seit 1989 durch eine große Beschleunigung gekennzeichnet waren. Zentrale Ereignisse und Prozesse dieser Phase wie die innergesellschaftliche Destabilisierung und die friedliche Revolution in der DDR, die Reaktionen der politischen Klasse in der Bundesrepublik hierauf sowie die Haltung der Großmächte USA und UdSSR und der bundesdeutschen Verbündeten Frankreich und Großbritannien zur "Deutschen Frage" sollen im Hauptseminar vor dem Hintergrund längerfristiger politischer Prozesse und den Ereignissen in den osteuropäischen Staaten untersucht werden.
Literatur:
Klaus-Dietmar Henke (Hrsg.): Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte, München 2009; Konrad H. Jarausch: Die unverhoffte Einheit, Frankfurt a. M. 1995; Gerhard A. Ritter: Der Preis der deutschen Einheit. Die Wiedervereingung und die Krise des Sozialstaats, München 2006; Andreas Rödder: Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung, München 2009.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung am 8. Februar von 10-12 Uhr in meiner Sprechstunde
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Halten eines Referates und Koreferates, Erstellen einer Hausarbeit
Migration in und aus Südosteuropa im 19. und 20. Jh.: Arbeitsmigration, Zwangsmigration, Transnationalismus
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 139
Zeit:
Mi 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
28.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
W 116
Südosteuropa gehört zu den Regionen Europas mit der größten Migrationsintensität – und zwar in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart. Die Beschäftigung mit dem komplexen gesellschaftlichen Phänomen Migration eröffnet daher nicht nur wichtige Perspektiven für das Verständnis der Entwicklung Südosteuropas, sondern kann auch dazu dienen, zentrale Konzepte der Migrationsforschung am Beispiel dieser Region zu diskutieren.
In diesem Hauptseminar sollen die wichtigen Migrationsbewegungen aus und in Südosteuropa in den letzten beiden Jahrhunderten sowie ihre vielfältigen Folgen diskutiert werden. U.a. geht es dabei um:
- Traditionelle saisonale Arbeitsmigration
- Amerikaauswanderung vor dem Ersten Weltkrieg
- Verschiedene Formen der Zwangsmigration
- „Gastarbeiter“-Migration nach dem Zweiten Weltkrieg
- Emigration nach dem Ende des Sozialismus
- Immigration nach Südosteuropa
- Transnationale Netzwerke
Literatur:
Alle relevanten Seminarunterlagen und -texte werden rechtzeitig im G.R.I.P.S. zur Verfügung gestellt.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: rosemarie.scheid@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Präsentation, aktive Mitarbeit, Seminararbeit
Der Zweite Weltkrieg und die Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Geschichte und Erinnerung
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 140
Zeit:
30.4., 14.5., 11.6., 2.7. jeweils 10-17
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
30.4.2010
Raum: (erneute Raumänderung!)
30.04.2010: H 15;
14.05.2010: WIOS 017;
11.06.2010: PT 1.0.6 (bis 12 Uhr); H 17 (bis 16 Uhr);
02.07.2010: WIOS 017
Obligatorische Veranstaltung für TeilnehmerInnen der Studienexkursion nach Bosnien-Herzegowina.
Als Anfang der 1990er Jahre Jugoslawien in Kriegen zerfiel, konnte man in den Medien, in politischen und wissenschaftlichen Publikationen von einem „Zuviel“ an Geschichte auf dem Balkan lesen. Von unterdrückten und eingefrorenen Erinnerungen insbesondere an den Zweiten Weltkrieg war die Rede; und davon, wie diese Erinnerungen in den 90er Jahren politisch manipuliert und missbraucht wurden und so die Spirale der Gewalt in den Kriegen der 90er Jahre anheizten. Im Hauptseminar soll exakt diese Schnittstelle - zwischen dem Zweiten Weltkrieg und seiner Erinnerung hin zu den Kriegen der 1990er Jahre in Jugoslawien - untersucht werden. Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Jugoslawien und der Zerfallskriege in den 1990ern werden ebenso diskutiert wie die Formen, Funktionen und Praktiken der Erinnerung an diese beiden einschneidenden Ereignisse.
Literatur:
Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall, Mannheim u.a.: B.I. Taschenbuch-Verlag 1993; Ders., Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von Erinnerungen und Mythen, in: Flacke, Monika, Hg., Mythen der Nationen: 1945 - Arena der Erinnerungen. Berlin: DHM 2004, Bd. 1, 373-426; Marie-Janine Calic, Der Krieg in Bosnien-Hercegovina: Ursachen, Konfliktstrukturen, internationale Lösungsversuche, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995; Steven L. Burg and Paul Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic conflict and international intervention, Armonk and London: Sharpe 1999; Branimir Anzulovic, Heavenly Serbia: From Myth to Genocide, New York and London: New York University Press, 1999
Anmeldung:
Anmeldung bis 1.April 2010 an: heike.karge@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
aktive Teilnahme, Präsentation, Seminararbeit
Oberseminare
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Oberseminar für Doktoranden, Magistranden und Bearbeiter von Zulassungsarbeiten
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 144
Zeit:
Mi 18-20
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
5.5.2010 (Terminänderung!)
Raum:
PT 2.0.9
Das Oberseminar soll in erster Linie Gelegenheit geben, Themen und Konzeptionen für Qualifikationsarbeiten und praktische Fragen der Durchführung in verschiedenen Bearbeitungsstadien gemeinsam zu erörtern. Daneben können auch allgemein interessierende Entwicklungen unseres Faches zur Debatte gestellt werden.
Literatur:
Anmeldung:
Die Teilnahme erfolgt in der Regel auf persönliche Einladung, doch können sich Interessenten auch gerne in meiner Sprechstunde vorstellen.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Oberseminar für Doktorand/innen, Magistrand/innen, Master- und Staatsexamenskandidat/innen
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 146
Zeit:
Di 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
In dem Oberseminar für Doktoranden, Magister-, Master- und Bachelorkandidat/innen sollen einerseits die individuellen Arbeiten vorgestellt und diskutiert werden. Dabei geht es auch um die Erörterung praktischer Probleme auf dem nicht immer einfachen Weg zu einer größeren wissenschaftlichen Arbeit. Andererseits werden auf Basis der gemeinsamen Lektüre einschlägiger Texte neue geschichtswissenschaftliche Ansätze aus dem Bereich der Transfer- und Verflechtungsgeschichte sowie der transnationalen Geschichte diskutiert.
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Proseminare
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Gestörte Kommunikation? Politisches Handeln im Reich zwischen Augsburger Religionsfrieden und Dreißigjährigem Krieg
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 165
Zeit:
Do 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Das Proseminar dient dem Erwerb und der praktischen Anwendung der Grundlagen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens am Beispiel der Reichsgeschichte zwischen 1555 und 1618; es richtet sich an Studierende des Basismoduls Neuere/Neueste Geschichte.
Schien mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 ein politischer Rahmen geschaffen, der die Handlungsfähigkeit des Reiches und seiner Institutionen trotz konfessioneller Spaltung gewährleisten konnte, so traten seit den 1580er Jahren verstärkt Konflikte um die vermeintlich „richtige“ Interpretation des Friedens zutage, die die Funktionsfähigkeit der Reichsorgane erheblich zu schwächen vermochten und in den Reichstagen von 1608 und 1613 zu kulminieren schienen.
Erkenntnisleitende Fragestellung des Proseminars bildet vor diesem Hintergrund die These einer „gestörten Kommunikation“ auf Reichsebene, die als hauptursächlich für den Ausbruch des 30jährigen Krieges beschrieben wurde (A. Gotthard). Die Plausibilität dieser Ansicht wird dabei einer kritischen Bewertung unterzogen werden müssen, welche vor allem auf die verbliebenen Räume kooperativen Handelns reflektiert und die Frage zu beantworten sucht, wie „unvermeidlich“ der Dreißigjährige Krieg tatsächlich war.
Literatur:
GOTTHARD, Axel: Das Alte Reich 1495-1806 (Geschichte kompakt), Darmstadt 2. Aufl. 2005; GOTTHARD, Axel: Der deutsche Konfessionskrieg seit 1619. Ein Resultat gestörter politischer Kommunikation, in: Historisches Jahrbuch 122 (2002), S. 141-172. HECKEL, Martin: Deutschland im konfessionellen Zeitalter (Deutsche Geschichte, Bd. 5), Göttingen 2. Aufl. 2001; REINHARD, Wolfgang: Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters, in: Zeitschrift für Historische Forschung 10 (1983), S. 257-277; SCHILLING, Heinz: Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Historische Zeitschrift 246 (1988), S. 1-45; SCHULZE, Winfried: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert (1500-1618), Frankfurt/M. 1987.
Hinweise:
Weiterführende Literatur wird im Rahmen des Seminars bekanntgegeben.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit/Referat, Klausur, Hausarbeit.
Das Reich im Zeitalter der Reformation 1500 - 1555
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 166
Zeit:
Mi 18-20
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ZH 1
Ein Tutorium wird angeboten.
Die im Propädeutikum gelernten Grundlagen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens werden in diesem Seminar an der Geschichte des Alten Reichs im Zeitalter der Reformation (1500-1555) erprobt. Die Jahrzehnte im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markieren einen der entscheidenden Wendepunkte nicht nur der deutschen, sondern der gesamten abendländischen Geschichte. Im Seminar sollen dabei zunächst Gründe und Vorläufer der Reformation in Gesellschaft und römischer Kirche beleuchtet werden. Zudem muß die politische Struktur des Reiches erläutert werden, um Entstehung und Entwicklung der Reformation verstehen zu können; doch auch die Rückwirkung der theologischen Innovationen auf die politischen Abläufe ist zu thematisieren. So wird die oft unübersichtliche Verquickung der heute getrennten Sphären Politik und Religion in der Frühen Neuzeit am praktischen Beispiel deutlich.
Literatur:
BLICKLE, Peter: Die Reformation im Reich. 3. Aufl. Stuttgart 2000; FREYTAG, Nils / PIERETH, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. 2. Aufl. Paderborn u. a. 2006; Lutz, Heinrich: Reformation und Gegenreformation. (OGG, Bd. 10) 5. Aufl. München 2002. OBERMAN, Heiko A.: Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel. Berlin 1987; Ders.: Zwei Reformationen. Luther und Calvin – Alte und Neue Welt. Berlin 2003; OPGENOORTH, Ernst / SCHULZ, Günther: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte. 6. Aufl. Paderborn 2001; SCHULZE, Winfried: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert. 1500-1618. Frankfurt/Main 1987.
Hinweise:
Zusätzliches Lehrangebot Lehrstuhl Prof. Luttenberger.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Anwesenheit, Mitarbeit, Referat, Klausur und Hausarbeit
Reform oder Reformation? Die deutschen Fürsten und ihr Verhältnis zur Lehre Martin Luthers
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 167
Zeit:
Do 12 - 14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ZH 1
Voraussichtlich fakultatives Tutorium
Die deutschen Territorialfürsten nahmen gegenüber der Glaubenslehre Martin Luthers und der durch ihn ausgelösten Reformation eine ganz unterschiedliche Haltung ein. Sie reichte von frühzeitiger freudiger Zustimmung wie etwa bei Markgraf Georg den Frommen von Brandenburg-Ansbach über konsequente Ablehnung wie bei Herzog Georg von Sachsen und den bayerischen Herzögen bis hin zu einer auf Vermittlung und Ausgleich bedachten Position, wie sie z. B. Kurfürst Joachim von Brandenburg einnahm. Hieraus ergibt sich ein facettenreiches Bild der reformatorischen Entwicklung in Deutschland, das Gelegenheit zu differenzierter und vergleichender Betrachtung bietet. Das Proseminar greift diese Chance auf und versucht so, den Studierenden eine der wichtigsten Epochen der deutschen Geschichte inhaltlich und methodisch näher zu bringen.
Literatur:
Albrecht P. Luttenberger, Glaubenseinheit und Reichsfriede. Konzeptionen und Wege konfessionsneutraler Reichspolitik 1530-1552 (Kurpfalz, Jülich, Kurbrandenburg), Göttingen 1982. - Anton Schindling/Walter Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reiches im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, 7 Bde., Münster 1992-1997. - Armin Kohnle, Reichstag und Reformation. Kaiserliche und ständische Religionspolitik von den Anfängen der Causa Lutheri bis zum Nürnberger Religionsfrieden, Heidelberg 2001. - Christoph Volkmar, Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen 1488-1525, Tübingen 2008.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung ab sofort in PT 3.1.84.
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, zwei Übungsaufgaben, Klausur, Hausarbeit.
Liberalismus im Deutschen Kaiserreich
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 168
Zeit:
Di 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Das Proseminar vermittelt neben allgemeinem teilfachspezifischen Grundwissen die theoretischen, methodologischen und arbeitstechnischen Grundlagen des Neuzeit-Historikers. Exemplarisch und vertiefend wird der kritische Umgang mit Hilfsmitteln, Forschungsliteratur und Quellen eingeübt. Am Ende des Seminars soll die Fähigkeit stehen, unter Anleitung fachwissenschaftlich arbeiten zu können.
Literatur:
BAUMGART, W.: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Handbücher, Quellen; FREYTAG, N./PIERETH, W.: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, 3., akt. u. erw. Aufl. Paderborn 2008; thematisch einführende Literatur wird in der ersten Sitzung genannt.
Hinweise:
Beachten Sie die Kopiervorlagen für die erste Sitzung im Seminarordner!
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort im Sekretariat bei Frau Wittmann (Öffnungszeiten beachten!). 10 Plätze werden für Erstsemester freigehalten.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Arbeitsauftrag/Referat; Klausur; Seminarararbeit
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1933-1945
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 169
Zeit:
Di 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit erfreut sich aktuell kaum ein Aspekt so ungebrochener Hochkonjunktur wie der Widerstand gegen die NS-Diktatur, und kaum mehr überschaubar ist die Zahl der zeitgeschichtlichen Studien, die das Thema ‘Widerstand’ aus den unterschiedlichsten Perspektiven problematisieren. Zudem ergießt sich zusätzlich eine wahre Flut von Erinnerungsliteratur auf den Büchermarkt, die noch durch die telegen inszenierte Geschichtsberieselung des Fernsehens ergänzt wird.
Das Proseminar greift das allgemeine Interesse an der Thematik auf und setzt sich zunächst eingehend mit den definitorisch-methodischen Problemlagen des Widerstandsbegriffs auseinander. Auf gesicherter theoretischer Basis erfolgt anschließend die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen von Resistenz und Opposition gegen das NS-Regime am Beispiel verschiedener politischer, gesellschaftlicher und konfessioneller Gruppen und Milieus. Einen thematischen Schwerpunkt bildet in diesem Kontext auch die Frage, welchen Einfluss Ausbruch und Verlauf des Vernichtungskrieges auf die führenden Köpfe der wichtigsten Widerstandsgruppen gehabt haben. Seinen Abschluss findet das Seminar in der Betrachtung der völlig gegensätzlich gelagerten Rezeption des Widerstands gegen das NS-Herrschaftssystem in den beiden sich nach 1945 herausbildenden deutschen Staaten.
Literatur:
Freytag, N./Piereth, W.: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, Paderborn u. a. 3. Aufl. 2008 [ND 2009]; Metzler, G.: Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, Paderborn u. a. 2004.
Altmeyer, Th. (Hg.): Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Perspektiven der Vermittlung. Tagung vom 17./18.03.2007 in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 2007; Benz, W./Pehle, W. H. (Hg.): Lexikon des deutschen Widerstandes, 2. Aufl. Frankfurt am Main 2004; Graml, H.: Widerstand, in: Benz, W. u. a. (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 5. akt. u. erw. Ausgabe München 2007, S. 343-357; Koehn, B.: Der deutsche Widerstand gegen Hitler. Eine Würdigung (Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 32), Berlin 2007; Leugers, A.: Deutscher Widerstand gegen den Nationalsozialismus, in: NPL 47 (2002), S. 249-276; Leugers, A.: Probleme der Widerstandsforschung. Puzzeln mit Mosaiksteinchen?, in: NPL 53 (2008), S. 393-400; Richardi, H.-G. (Hg.): Für Freiheit und Recht in Europa. Der 20. Juli 1944 und der Widerstand gegen das NS-Regime in Deutschland, Österreich und Südtirol, Innsbruck 2009; Roth, K. H./Ebbinghaus, A. (Hg.): Rote Kapellen, Kreisauer Kreise, Schwarze Kapellen. Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938-1945, Hamburg 2004; Steinbach, P./Tuchel, J. (Hg): Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur 1933-1945 (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 438), Bonn 2004 [zur (fast) kostenlosen Anschaffung bei der BpB dringend empfohlen!]; Tuchel, J. (Hg.): Der vergessene Widerstand. Zu Realgeschichte und Wahrnehmung des Kampfes gegen die NS-Diktatur (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte, Bd. 5), Göttingen 2005.
Anmeldung:
Anmeldung für die ersten 15 Plätze ab sofort von 10-12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Ab Donnerstag, den 15. April 2010 von 10-12 Uhr werden die restlichen 10 Plätze vergeben und zwar ausschließlich an Studierende im ersten Fachsemester! Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Voraussetzungen für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, die Übernahme von Arbeitsaufträgen bzw. eines fachspezifischen Referats, das Bestehen der Abschlussklausur sowie die Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit.
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) - Die „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 170
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
1st. fakultatives Tutorium: s. Aushang.
Für den britischen Historiker Niall Ferguson war es der „falsche Krieg“, George F. Kennan bezeichnete den Ersten Weltkrieg als die „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Der Erste Weltkrieg beendete das „lange 19. Jahrhundert“, und läutete auf den Schlachtfeldern von Verdun und der Somme, der Marne und Flanderns die Moderne ein. Dieser bis dahin beispiellose Konflikt sollte das 20. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein nachhaltig prägen.
Neben der Beschäftigung mit den Schlachtfeldern, wie der West- und Ostfront oder des Balkans, wird der Blick auch auf die zum Einsatz gekommene neue Technik, sowie auf die Kriegspropaganda, die Kriegswirtschaft, die Strategien und die Führung des Deutschen Reiches im Inneren gerichtet werden. Ebenfalls thematisiert wird das „Epochenjahr 1917“.
Dabei führt das Proseminar insbesondere in die theoretischen, methodologischen und arbeitstechnischen Grundlagen des Neuzeit-Historikers ein. Ausgehend vom Seminarthema wird der kritische Umgang mit Hilfsmitteln, Forschungsliteratur und Quellen anhand der bereits erworbenen Kenntnisse aus dem Propädeutikum vertieft, um so die Grundlagen für selbständiges historisches Arbeiten in späteren Studienabschnitten zu schaffen.
Literatur:
CORNELIßEN, Ch. (Hg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung, Frankfurt a. M. 2000; FREYTAG, N. - PIERETH, W.: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, Paderborn u. a. 2004; zur Einführung in das Thema (Auswahl): BAUMGART, W.: Deutschland im Zeitalter des Imperialismus 1890-1914. Grundkräfte, Thesen und Strukturen, 5. Aufl., Stuttgart u. a. 1986; FERGUSON, N.: Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, Stuttgart 1999; HILDEBRAND, K.: Deutsche Außenpolitik 1871-1918, München 1989; MOMMSEN, W. J.: Der Erste Weltkrieg. Anfang vom Ende des bürgerlichen Zeitalters, Frankfurt am Main 2004; STEVENSON, D.: 1914-1918. Der Erste Weltkrieg, Düsseldorf 2006.
Hinweise:
Beachten Sie die Kopiervorlagen für die erste Sitzung im Seminarordner!
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort von 10-12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Die dafür notwendigen Leistungsnachweise haben die Studierenden in Form von Arbeitsaufträgen, Kurzreferaten, Rechercheaufgaben, Klausur und Seminararbeit zu erbringen.
Wie kam Hitler an die Macht? – Von der Auflösung der Weimarer Republik zum „Führerstaat“ 1929-34
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 171
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 1.0.6 (Raumänderung!)
Das Proseminar führt zunächst in die Epochen der Neueren und Neuesten Geschichte sowie der Zeitgeschichte und die entsprechenden theoretischen und methodischen Arbeitsgrundlagen des Historikers ein. Diese Techniken werden sodann in der Auseinandersetzung mit einer der ganz zentralen Leitfragen der deutschen Zeitgeschichte eingeübt, nämlich wie es passieren konnte, dass die Deutschen die Weimarer Demokratie preisgaben und Adolf Hitler die annähernd totale Macht im Staat ergriff.
Literatur:
Freytag, Nils u.a. (Hg.): Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, Paderborn u.a. 4. Aufl. 2009.
Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik, München 7. Aufl. 2009.
Hildebrand, Klaus: Das Dritte Reich, München 7. Aufl. 2009.
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Anwesenheit, Arbeitsaufträge/Referate, Klausur und Hausarbeit.
Aktuelle Mitteilung:
Das Proseminar ist voll belegt. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich.
Die Weimarer Republik
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 171a
Zeit:
Mi 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
W 112 (Raumänderung!)
Das Proseminar vermittelt allgemein teilfachspezifisches Grundwissen und führt ein in die theoretischen, methodologischen und arbeitstechnischen Grundlagen des Neuzeit-Historikers. In Orientierung am Seminarthema – der Weimarer Republik – werden der kritische Umgang mit Hilfsmitteln, der Forschungsliteratur und Quellen eingeübt und vertieft.
Literatur:
Baumgart, W.: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Handbücher, Quellen, 16., korr. Aufl., München 2006; Cornelißen, Ch. (Hg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung, Frankfurt a. M. 2000; Freytag, N. / Piereth, W.: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, 3. Aufl., Paderborn u. a. 2004; zur Einführung in das Thema: Kolb, E.: Die Weimarer Republik (OGG 16), 6., überarb. und erw. Aufl., München 2002; Kluge, U.: Die Weimarer Republik, Paderborn 2006; Büttner, U.: Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933. Leistung und Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Stuttgart 2008; Winkler, H. A.: Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten Deutschen Demokratie, 4., durchgesehene Auflage München 2005.
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort von 10-12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Höchstteilnehmerzahl: 25
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Arbeitsaufträge, Referate, Rechercheaufgabe, Klausur, Seminararbeit
Die Weltkriege im östlichen Europa
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 172
Zeit:
Di 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 3.3.50
Dieses Proseminar befaßt sich mit der Geschichte der Länder Osteuropas im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Blickfeld stehen dabei Russland bzw. die Sowjetunion, Polen, die Ukraine und die Tschechoslowakie. Anhand ausgewählter Forschungsfelder näheren wir uns dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und üben dabei auch Methoden wissenschaftlichen Arbeitens ein.
Literatur:
Beyrau, Dietrich, Schlachtfeld der Diktatoren. Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin. Göttingen 2000.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per Email an: Natali.Stegmann@geschichte.uni-r.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Das besetzte Polen
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 172a
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
CH 13.0.82 (Raumänderung!)
Für das kulturelle Gedächtnis der polnischen Bevölkerung ist die deutsche Besatzungsherrschaft bis heute die zentrale Kriegserfahrung. Das Proseminar wird entsprechend in die Geschichte Polens im Zweiten Weltkrieg einführen und dabei Aspekte wie die Besatzungsherrschaft und ihre Akteure, die Ingangsetzung des Holocaust sowie den Alltag der Okkupierten einschließlich der Auswirkungen von Kooperation und Widerstand thematisieren. Zu unterscheiden sein wird dabei zwischen jenen westpolnischen Gebieten, die dem Deutschen Reich einverleibt wurden, dem Generalgouvernement sowie dem zunächst von der Sowjetunion bis 1941 annektierten, dann deutsch besetzten Ostpolen.
Literatur:
Deutsch-polnische Beziehungen 1939 – 1945 – 1949. Eine Einführung, hrsg. v. W³odzimierz Borodziej und Klaus Ziemer, Osnabrück 2000.
Szarota, Tomasz: Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten War-schau, Paderborn 1985.
Broszat, Martin: Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: toensmeyert@aol.com
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Besonderer Hinweis:
Dies ist eine zusätzliche Veranstaltung, die nicht im vorläufigen Online-Vorlesungsverzeichnis aufgeführt ist.
„Faschismus“ in Deutschland, Südeuropa und auf dem Balkan - Faschistische und faschistoide Bewegungen und autoritäre Staatsformen im Vergleich, 1919-1945
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 173
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Schwerpunkt des Seminars wird der Vergleich sein. Vom italienischen und deutschen Fall ausgehend werden vor allem südosteuropäische Faschismen sowie autoritäre Bewegungen und Regime diskutiert, vorgestellt und kontextualisiert. Zum einen soll das Seminar versuchen, die Entwicklungswege, Ideologien und Bedingungen der Bewegungen und Staatsformen nachzuvollziehen. Zum anderen sollen Typologien erarbeitet werden, die uns ermöglichen die Zwischenkriegszeit überblickend zu verstehen. Ferner sollen die einzelnen Ideologien und Bewegungen in Bezug auf ihr Verhältnis zum Holocaust/genozidären Programm, zur Moderne, zu Imperium/Expansion, Krieg, Frauen und Kirche exemplarisch diskutiert werden. Neben den Grundzügen vergleichender Geschichte sollen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden.
Literatur:
Altrichter, Helmut u. Walther L. Bernecker: Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Stuttgart 2004; Payne, Stanley G.: A History of Fascism, 1914-1945. Madison 2001; Wippermann, Wolfgang: Europäischer Faschismus im Vergleich (1922-1982). Frankfurt a. M. 1983; Ursprung, Daniel: „Faschismus in Ostmittel- und Südosteuropa - Theorien, Ansätze, Fragestellungen". in: Mariana Hausleitner (Hg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. München 2006, S. 9-52; Griffin, Roger: The Nature of Fascism. London & New York 1993.
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Klausur, Kurzreferat und Hausarbeit
Geschichte der frühen Republik Türkei – Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 174
Zeit:
Do 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ALFI 017
Der Übergang vom dynastischen und multiethnischen Osmanischen Reich zu einem modernen Nationalstaat war ein schwieriger. Ja, die moderne Republik Türkei wurde im Krieg – gegen Griechenland und die Alliierten – geboren und im Frieden von Lausanne (1923) „getauft“. Danach setzte eine beeindruckende Reformtätigkeit ein. Und wie sah dann die junge Republik Türkei aus als ihr Gründer Kemal Atatürk 1938 starb? Welche Fundamente wurden für ihre weitere Entwicklung gelegt? Atatürks Regime wird oft als „Erziehungsdiktatur“ klassifiziert. In wie fern diese Bezeichnung gerechtfertigt ist, wird hier u.a. diskutiert werden müssen. Das Seminar versteht sich als Einführung in die Geschichte eines südosteuropäischen Landes und will somit auch eine Annäherung an die Geschichte von Raum und Zeit ermöglichen. Ferner sollen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden.
Literatur:
Kreiser, Klaus u. Christoph K. Neumann: Kleine Geschichte der Türkei. Stuttgart 2003; Kasaba, Resat (Hg.): The Cambridge History of Turkey - Volume 4: Turkey in the Modern World. Cambridge 2008; Kreiser, Klaus: Atatürk - Eine Biographie. München 2008; Ahmad, Feroz: Geschichte der Türkei. Essen 2005.
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Klausur, Kurzreferat und Hausarbeit
Wissenschaftliche Arbeitstechniken; Methoden der Geschichts- und Kulturwissenschaft; Präsentationstechniken
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 175
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
ALFI 017
Das Proseminar richtet sich in erster Linie an Studienanfänger sowie Studierende der ersten Semester und bietet einen ersten Einblick in die Methoden und Hilfsmittel des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Neben der Vermittlung von methodischen Kenntnissen bietet das Proseminar vielfältige Möglichkeiten zur forschungspraktischen Anwendung zentraler Arbeits- und Präsentationstechniken (Bsp. Recherche/Archivbesuch/Quellenarbeit). Das Proseminar führt andererseits in wichtige geschichts- und kulturwissenschaftliche Theorien ein und soll Studierende zur Reflexion über die Grundlagen des eigenen Fachs anregen. Wir werden uns dabei sowohl mit zentralen Autoren der Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie mit dem speziellen Erkenntnissinteresse ausgewählter Teildisziplinen (wie bspw. Sozial-, Kultur-, Alltags-, Geschlechter-Geschichte, historische Anthropologie) auseinandersetzen. Um gleichzeitig eine erste Einführung in die theoretischen Besonderheiten der Südosteuropa-Forschung zu bieten, werden wir uns mit historischen Raumvorstellungen von Südost-, Mittel und Osteuropa befassen.
Reader:
Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Literatur zur Einführung:
Nils Freytag, Wolfgang Piereth: Kursbuch Geschichte. Paderborn, München und Wien 2006. Ute Daniel: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt/Main 2001. Ernst Opgenoorth: Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Paderborn 1997. Harald Roth (Hg.): Studienhandbuch Östliches Europa. Band 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas.
Anmeldung:
Bitte bis zum 05.04.2010 an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de und tegeler@suedost-institut.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle- Beteiligung, 10 min. Referat mit Handout)
- Sprachklausur (Semestermitte)
- Abschlussklausur
- 5-seitiger Essay (inklusive 3-seitige Bibliographie/Abstract)
History of Children and Childhood in Twentieth Century: Eastern and Western Perspectives.
Veranstaltungstyp:
Proseminar (in English)
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 176
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
ALFI 017
Tutorium: An additional tutorial will be offered.
In this seminar students will gain a practical insight into the Anglo-American style of undergraduate seminars. The course will be taught in English and will train students in reading English texts, giving an oral presentation in English and in writing both a written exam and a final essay in English. Thematically we will deal with the history of of children and childhood in Eastern-, Southeastern-, and Western Europe. We will learn how children and childhood as objects of historical investigation have in recent years turned into a prominent topic of twentieth century history research, in as far as their study exposed their significant contribution to our knowledge of social history. Throughout modern history children always had a great societal value which made their well-being into an object of public undertaking. They were meant to be cared for, to be kept clean, acurately dressed, nutriously fed, well educated and socially integrated. As political crisis, wars and genocides extensively shaped the twentieth century, we will study how these historical moments left far-reaching traces on children. The seminar will furthermore examine how class, gender, race and ethnicity have influenced the life of children and their families and how they have affected the notion of childhood throughout the twentieth century.
Reader:
A complete reader will be made available online at (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php).
Introductory Literature: Philippe Ariés: Centuries of Childhood: a social history of family life. London 1973. Sabine Hering, Wolfgang Schröer (Ed.): Sorge um die Kinder. Beiträge zur Geschichte von Kindheit, Kindergarten und Kinderfürsorge, Weinheim 2008. Lloyd DeMause: The History of Childhood. New York 1974. Catriona Kelly: Children’s World. Growing up in Russia. Oxford 2007. Slobodan Naumovic, Miroslav Jovanovic (Ed.): Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing up in the 19th and 20th Century. Münster 2004.
Hinweise:
The entire seminar will be held in English. (including presentations/ essays).
Anmeldung:
Registration until 5th of April 2010 via email to friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de or via https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- active and continuous participation (including Moodle-participation, 10 min. presentation)
- obligatory language exam
- final written exam
- final essay (10-15 pages)
Die erzählte Grenze: lebensgeschichtliche Erinnerungen und Erinnerungsorte im bayerisch-böhmischen Grenzraum.
Veranstaltungstyp:
Proseminar mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 177
Zeit:
Mi 8.00-9.30 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich (mit einer Blockveranstaltung in Exkursionsform)
Beginn:
21.4.2010
Raum:
CH 13.0.82 (Raumänderung!)
Tutorium: Ein begleitendes, aber freiwilliges Tutorium wird angeboten.
Während der Eiserne Vorhang in erster Linie als Hindernis für den Transfer von Menschen, Ideen und physischen Gütern betrachtet wird, weckt die Metapher der Grenze auch gleichzeitig Vorstellungen von grenzüberschreitender Interaktion und Kommunikation. Die Vielschichtigkeit des individuellen und kollektiven Gedächtnisses in Bezug auf die Grenze, deren Charakter im 20. Jahrhundert mehrfache tiefgreifende Veränderungen durchlief, ist Gegenstand dieses Proseminars. Im Sinne einer mikrohistorischen Studie werden wir uns mit der lokalen Erinnerung an den Eisernen Vorhang im bayerisch-böhmischen Grenzraum beschäftigen. Wir werden uns dabei sowohl mit der mündlichen Repräsentation der Grenze in Lebensgeschichten, als auch mit ihrer visuellen Präsentation an ausgesuchten Erinnerungsorten auseinandersetzen. Mit Hilfe von biographischen Interviews mit Menschen aus der Region, deren alltägliches Leben von der Präsenz der Grenze geprägt war, möchten wir individuelle und biographische Grenz-Erfahrungen aufspüren. Es ist zu vermuten, dass der Eiserne Vorhang als physische Grenze auf beiden Seiten der bayerisch-böhmischen Grenze zum aktiven Widerstand gegen die fortschreitende Isolierung der – an den Eisernen Vorhang grenzenden - Regionen provozierte. Als Vorbereitung auf die eigenständig durchzuführenden Interviews wird das Seminar vielfältige Möglichkeiten bieten, methodologische und praktische Grundlagen der lebensgeschichtlichen Interviewführung zu erwerben. Die erlernten Interviewtechniken sowie theoretische Kenntnisse über die historische Funktion „erinnerter Orte“ werden wir dann im Rahmen einer zweitägigen Exkursion ins bayerisch-böhmische Grenzgebiet forschungspraktisch anwenden.
Reader:
Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Literatur zur Einführung:
Roswitha Breckner, Devorah Kalekin-Fishman und Ingrid Miethe: Biographies and the division of Europe: experience, action, and change on the 'Eastern side'. Opladen 2000. Katharina Eisch: Grenze. Eine Ethnographie des bayerisch-böhmischen Grenzraums. München 1996. Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinkke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg 2003. Robin Humphrey: Biographical research in Eastern Europe. Altered lives and broken biographies. Aldershot 2003. Patrick Major und Rana Mitter: Across the Blocs. Cold War Cultural and Social History. London 2004. Ulrike H. Meinhof: Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe. Ashgate 2002. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1998.
Hinweise:
- Das Seminar ist interdisziplinär.
- Gute englische Sprachkenntnisse sind erforderlich, tschechische Sprachkenntnisse nicht erforderlich, aber sehr willkommen.
Anmeldung:
Ab sofort und bis zum 05.04.2010 an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de und veronika.hofinger@web.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle-Beteiligung, 10 min. Referat mit Handout und 10 min. Diskussionsleitung)
- Sprachklausur (Semestermitte)
- Abschlussklausur: (Filmanalyse)
- Durchführung eines eigenen Interviews (inkl. Transkription und Entwicklung einer 2-seitigen Forschungsthese)
Übungen
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Der Herr und seine Diener. Höfische Machteliten in der Frühen Neuzeit.
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 184
Zeit:
Mi 11-13 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
CHE 33.1.89
Im Zuge der historischen Meistererzählung vom Aufstieg des modernen Staates in Europa wurden die verschiedensten Faktoren namhaft gemacht, die diese Entwicklung befördert hätten: Regelmäßige Besteuerung, konfessionelle Einheitlichkeit oder stehende Heere seien hier nur beispielhalber genannt. Von der Forschung etwas stiefmütterlich behandelt wurde dabei das herrscherliche Personal, das diesen Konzentrationsprozeß politischer Entscheidungskompetenz überhaupt ermöglichte. Dabei waren es gerade die höfischen Machteliten, die als fürstlicher Stab zäh und weitgehend abseits der Kontingenz menschlicher Reproduktion in den herrschenden Dynastien, das „Wachstum der Staatsgewalt“ (W. Reinhard) beförderten. Dieser Personengruppe will sich die Übung anhand unterschiedlicher Quellen zuwenden; dabei sollen diachrone Wandlungen im Typus des Fürstendieners herausgearbeitet und die oftmals prekäre Abhängigkeit vom Fürsten thematisiert werden.
Literatur:
GRELL, Chantal / MALETTKE, Klaus (Hrsg.): Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jh.). Internationales Kolloquium der Philipps-Universität Marburg in Zusammenarbeit mit der Universität Versailles Saint-Quentin vom 28. zum 30 September 2000. (Forschungen zur Geschichte der Neuzeit, Bd. 1) Münster 2001; KAISER, Michael / PEČAR, Andreas (Hrsg.): Der zweite Mann im Staat. Oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit. (ZHF, Beiheft 32) Berlin 2003; REINHARD, Wolfgang: Freunde und Kreaturen. Historische Anthropologie von Patronage-Klientel-Beziehungen, in: Freiburger Universitätsblätter 139, 1998, S. 127-141; REINHARD, Wolfgang (Hrsg.): Power Elites and State Building. (The Origins of the modern State in Europe, Theme D) Oxford 1996.
Hinweise:
Zusätzliches Lehrangebot Lehrstuhl Prof. Luttenberger.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Anwesenheit, Mitarbeit und Hausarbeit
Die Macht des Geldes: Bankiersdynastien in der frühen Neuzeit
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 185
Zeit:
Do 12 - 14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Familien wie die Medici in Florenz oder die Fugger in Augsburg brachten es dank ihrer Handels- und Bankgeschäfte nicht nur zu erheblichem Reichtum – es war ihnen auch möglich ihr ökonomisches Kapital in gesellschaftliches Prestige und nicht zuletzt in konkrete Herrschaftstitel umzuwandeln. Im Rahmen der Übung soll mittels der Beleuchtung unterschiedlicher Bereiche der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise der Transformationsprozess von Geld in konkrete (Herrschafts-) Macht forciert wurde. Besonderes Augenmerk soll dabei auf den Aufstieg der Familien der Medici und der Fugger, häufig auch als die „deutschen Medici“ bezeichnet, gelegt werden, wobei im direkten Vergleich Gemeinsamkeiten sowie Differenzen herausgearbeitet werden sollen. Bei Interesse kann die Übung mit einer Exkursion nach Augsburg abgeschlossen werden.
Literatur:
REINHARDT, Volker: Die Medici. Florenz im Zeitalter der Renaissance. München 1998. HÄBERLEIN, Mark: Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie (1367 - 1650). Stuttgart 2006.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
- 05.1 - 07.1
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Anwesenheit, Referat, Essay
Begleitlektüre zur Vorlesung: Vergleichende Analyse der großen
europäischen Verfassungskodifikationen des 19. und 20. Jahrhunderts
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 186
Zeit:
Do 10-12
Dauer:
1 Semesterwochenstunde
Turnus:
14-täglich
Beginn:
29.4.2010
Raum:
PT 2.0.9 (Raumänderung!)
Quellenlektüre und vergleichende Textanalyse.
Literatur:
Hinweise:
Englische und und französische Sprachkenntnisse sind erforderlich.
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort von 10 - 12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69); Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
2
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, aktive Beteiligung an den Erörterungen in der Gruppe, individuelle schriftliche und mündliche Aufgaben: analytische Lektüreprotokolle, Inhaltsreferate, Kontextrekonstruktionen.
Wilhelm Heinrich Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft (Lektüre, Kontextualisierung, Interpretation)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 187
Zeit:
Mi 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Wilhelm Heinrich Riehl, früher „Gesellschaftswissenschaftler“ und konservativer Publizist zugleich, schrieb in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhundert eine einflußreiche Deutung seiner eigenen Gegenwart – also inmitten jenes grundstürzenden sozioökonomischen Umbruchs, der durch den industriellen „take-off“ massive Verwerfungen der überkommenen Gesellschaftsordnung zeitigte. Trotz – oder wegen? – seiner ideologischen Implikationen bietet Riehls bürgerliche Gesellschaft auch heute noch Erhellendes für das Verständnis der entstehenden industriellen Moderne.
Der dicht geschriebene, anspielungsreiche Text soll im Seminar kapitelweise kontextualisiert und gemeinsam interpretiert werden.
Literatur:
RIEHL, W. H.: Die bürgerliche Gesellschaft. Hg. u. eingel. v. Peter Steinbach, Frankfurt/M. u.a. 1976. [Der Text ist vergriffen; das Bibliotheksexemplar kann aber im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Bauer (Frau Wittmann; PT 3.1.69) eingesehen und zum Fotokopieren abgeholt werden; eine Version soll in den digitalen Semesterapparat gestellt werden]. Eine für die Referate grundlegende Auswahlbibliographie wird am Anfang des Seminars vorgestellt.
Hinweise:
Möglichkeit zur Themenvorbesprechung in meinen Sprechstunden ab Anfang März.
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Bauer (Frau Wittmann; PT 3.1.69). Möglichkeit zur Themenvorbesprechung in meinen Sprechstunden ab Anfang März.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat und Essay-Klausur
Die Geschichte des politischen Zionismus. Von Theodor Herzls „Judenstaat“ bis zur Gründung des Staates Israel.
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 188
Zeit:
Do 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PHY 9.1.11
„Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen“ schreibt Theodor Herzl, den man als den Begründer des politischen Zionismus bezeichnet, im Untertitel seines 1902 verfassten utopischen Romans „Altneuland“, in dem er das Ideal eines zukünftigen jüdischen Staates darstellt. Der politische Zionismus nahm im Zeitalter des europäischen Nationalismus im 19. Jahrhundert Gestalt an. Mit der Erkenntnis, dass der Kampf um die Anerkennung und Integration in der Gesellschaft ihrer Umwelt aussichtslos sei, entdeckten jüdische Intellektuelle Ihr Judentum nicht nur neu, sondern definierten es auch als Nationalität. Die eigentliche Heimat sahen sie im vermeintlichem Land der Väter, dem „Eretz Israel“, dessen Besiedlung endgültig die so genannte „jüdische Frage“ lösen sollte, d.h. die scheinbar unlösbare Problematik im Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden. Und in der Tat entstand aus den zunächst vagen Ideen jüdischer Denker wie Moses Heß, Leon Pinsker und Theodor Herzl nicht nur die Zionistische Bewegung, sondern der moderne Staat Israel. Anhand gemeinsamer Lektüre, der Interpretation ausgewählter Quellen und thematischen Referaten soll das Thema Zionismus, ausgehend von seinen Ursprüngen im 19. Jahrhundert, über die ersten Zionistenkongresse und Einwanderungswellen nach Palästina, bis zur Gründung des Staates Israel 1948 gemeinsam erarbeitet werden.
Literatur:
BRENNER, M.: Geschichte des Zionismus, München 2008; HAUMANN, H.: Der Traum von Israel. Die Ursprünge des modernen Zionismus, Weinheim 1998; RUBINSHTAIN, A.: Geschichte des Zionismus. Von Theodor Herzl bis heute, München 2001; SAND, S.: The Invention of the Jewish People, London 2009; SOLOMON, N.: Judentum. Eine kurze Einführung, Stuttgart 2006.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, Arbeitsaufträge, Referat, Klausur
„Der Weltgeist zu Pferde“? Aufstieg und Fall Napoleon Bonapartes 1795-1814/15
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 189
Zeit:
Do 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
W 112 (Raumänderung!)
Im Gefolge des sog. „Bicentenaire“ des Jahres 2004 hat die bis dahin schon ungebrochen rege Napoleon-Forschung noch eine weitere Intensivierung erfahren, aus der neben einer Fülle von Sekundärliteratur unterschiedlichster Provenienz auch eine Reihe von modernen Quelleneditionen hervorgegangen ist. Auf Basis der Lektüre einschlägiger Quellen widmet sich die Übung zunächst dem persönlichen Aufstieg Napoleon Bonapartes, der ihn über den Staatsstreich vom 18. Brumaire zunächst zum Ersten Konsul des revolutionären Frankreichs und 1804 gar zum Kaiser der Franzosen avancieren ließ. Da der Aufstieg Napoleons untrennbar mit seinen militärischen Erfolgen verknüpft war, die endgültig auch erst bei Waterloo endeten, versteht es sich von selbst, dass ein thematischer Schwerpunkt der Lehrveranstaltung zunächst in der Auseinandersetzung mit der territorialen Expansionspolitik des napoleonischen Frankreich liegen muss.
Abseits allen Schlachtenlärms versucht die Übung dann in einem zweiten Teil das historische Vermächtnis des vermeintlichen „Weltgeistes zu Pferde“ (G. W. F. Hegel) kritisch zu würdigen, indem sie die von Napoleon initiierten politisch-gesellschaftlichen Wandlungsprozesse analysiert und deren Einfluss auf die europäischen Nationalbewegungen einer eingehenden Betrachtung unterzieht.
Literatur:
Dwyer, G./Forrest, A. (Eds.): Napoleon and His Empire. Europe 1804-1814, Basingstoke 2007; Esdaile, C. J.: Napoleon’s Wars. An International History, 1803-1815, London 2007; Fehrenbach, E.: Vom Ancien Régime zum Wiener Kongress (OGG, Bd. 12), 5. Aufl. München 2008; George, M./Rudolph, A. (Hg.): Napoleons langer Schatten über Europa, Dettelbach 2008; Hinrichs, E. (Hg.): Kleine Geschichte Frankreichs, Bonn 2005 [zur (fast) kostenlosen Anschaffung bei der BpB dringend empfohlen!]; Pelzer, E.: Napoleons neue Kleider? Neuerscheinungen rund um die 200-Jahrfeier der Kaiserkrönung, in: NPL 52 (2007), S. 245-292; Planert, U.: Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden. Alltag, Wahrnehmung, Deutung 1792-1814 (Krieg in der Geschichte, Bd. 33), Paderborn 2007; Ullrich, V.: Napoleon. Eine Biographie, Reinbek 2004.
Hinweise:
Geeignet für Studierende im Grund- und Hauptstudium. Französischkenntnisse (Lesefähigkeit) wünschenswert, aber keine Bedingung!
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort von 10-12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Voraussetzung für den Scheinerwerb (Theorie- und Methodenschein oder Quellenschein) sind regelmäßige Teilnahme, Vorbereitung der entsprechenden Texte, Übernahme eines Referates bzw. einer Sitzungsmoderation sowie das Bestehen der Abschlussklausur.
Von der Expansion zur Erosion: Entstehung, Struktur und Niedergang des spanischen Kolonialreiches 1492-1898
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 190
Zeit:
Fr 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
PT 1.0.6 (Raumänderung!)
Keineswegs zufällig begann mit dem vorläufigen Abschluss der spanischen ‘Reconquista’ die außereuropäische Expansion Spaniens nach Amerika, Asien und Afrika. In Form eines Überblicks widmet sich die Übung der Entstehung, der Struktur und dem sukzessiven Zerfall eines Kolonialreiches von ehemals gewaltigem Ausmaß, wobei die Betrachtung der hispanoamerikanischen Kolonien Mittel- und Südamerikas – wenn auch nicht ausschließlich – den thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung bilden werden. Diese Vorgehensweise begründet sich zunächst in der, verglichen mit den asiatischen und afrikanischen Besitzungen, für die spanische Zentralregierung ungleich höheren Bedeutung der neuspanischen Vizekönigreiche Altamerikas. Des Weiteren ist gerade die ‘Conquista’ Amerikas häufig mit einer Reihe von Stereotypen und Einseitigkeiten besetzt, die in einigen Details, insbesondere hinsichtlich des Umgangs der Spanier mit der indigenen Bevölkerung, einer um Ausgewogenheit bemühten, kritischen Revision bedürfen. Schließlich resultiert die Konzentration auf den amerikanischen und karibischen Raum – drittens – aus der Tatsache, dass der mit Beginn des 19. Jahrhunderts verschärft einsetzende kontinuierliche Erosionsprozess des spanischen Kolonialreiches in den amerikanischen Gebieten seinen Anfang nahm und 1898 im Verlust Kubas an die USA seinen vorläufigen Höhepunkt fand.
Literatur:
Bernecker, W.L./Pietschmann, H. (Hg.): Geschichte Spaniens. Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, 4. überarb. und aktual. Aufl. Stuttgart 2005; Bernecker, W. L./Pietschmann, H. (Hg.): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Bd. 1: Mittel-, Südamerika und die Karibik bis 1760, Stuttgart 1994; Bd. 2: Lateinamerika von 1760 bis 1900, Stuttgart 1992; Pietschmann, H.: 500 Jahre Entdeckung Amerikas (Kirche und Gesellschaft, H. 16), Köln 1992; Prem, H. J.: Geschichte Altamerikas (OGG, Bd. 23), 2., völlig überarb. Aufl. München 2008; Schmidt, P. (Hg.): Kleine Geschichte Spaniens, Bonn 2005. [Zur (fast) kostenlosen Anschaffung bei der BpB dringend empfohlen!]; Volger, G.: Gold, Ruhm und Evangelium. Der Wiederentdecker Amerikas als Verkörperung der europäischen Expansion, in: AKG 88 (2006), S. 323-354.
Hinweise:
Geeignet für Studierende im Grund- und Hauptstudium. Spanischkenntnisse (Lesefähigkeit) hilfreich, aber ausdrücklich keine Bedingung!
Anmeldung:
Anmeldung ab sofort von 10-12 Uhr durch Listeneintrag bei Frau Wittmann im Sekretariat Prof. Bauer (PT 3.1.69). Höchstteilnehmerzahl: 25.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Voraussetzung für den Scheinerwerb (Theorie- und Methodenschein oder Quellenschein) sind regelmäßige Teilnahme, Vorbereitung der entsprechenden Texte, Übernahme eines Referates bzw. einer Sitzungsmoderation sowie das Bestehen der Abschlussklausur.
Sites of Everyday Life in Socialist Czechoslovakia
Veranstaltungstyp:
Übung - Projektübung in englischer Sprache
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 207
Zeit:
24. bis 29. Mai 2010 (Blockveranstaltung in Prag an der Karlsuniversität)
Dauer:
Turnus:
Beginn:
Raum:
Die Verstaltung wird gemeinsam mit dem Kollegen Michal Pullmann von der Karlsuniversität in Prag durchgeführt.
Block course in Prague from 25.-28. May 2010, held by Michal Pullmann (Carls-University Prague) and Natali Stegmann (Universität Regensburg) in the framework of Erasmus-Programme (universities partnership).
Throughout four days of intensive work we will study sites of everyday life in socialist Czechoslovakia with students from Prague and Regensburg. The course will rather focus on the question, how people lived in socialism, than discussing problems of political systems. During the morning sessions we start with studying texts on different fields of everyday organisation and the functioning of socialist societies from a social and cultural historical perspective. In the afternoons we will tour the city and the neighbourhood, visiting certain points of interest, telling stories about the lives and faiths of the citizens of the former socialist Czechoslovak state. This will be workplaces, living areas, and places of recreation, monuments or meeting places. Each student will be asked to give a short presentation about one of these places or about certain historical phenomena. Access to the course is limited to 12 students from Regensburg and 12 from Prague (additionally 6 from Deutsch-Tschechische Studien in their fourth semester studying in Prague). For students coming from Regensburg to participate in the course in Prague we have applied for funding of their travel expenses.
Literatur:
Alexei Yurchak, Everythink Was Forever, Untill It Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton 2005.
Anmeldung:
Students from Prague and from Deutsch-Tschechische Studien should contact: Michal.Pullmann@ff.cuni.cz
Students from Regensburg should contact: Natali.Stegmann@geschichte.uni-regensburg.de.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2 - 14.3 - 15.5
GES-M
10.3 - 05.4 - 07.4
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
aktive Teilnahme, ausgearbeitetes Referat
Die Türkei als europäisches und südosteuropäisches Land? Historische Standortbestimmungen und -diskussionen
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 208
Zeit:
Mi 8-10 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
In den vergangenen Jahren hat durch den EU-Beitrittswunsch der Republik Türkei die schon Jahrhunderte währende Frage nach der Europäizität der Türkei eine neue Brisanz bekommen. Absolute Antworten sind hier zu Felde geführt worden (wie zum Beispiel, die Türkei sei einfach ein asiatisches Land). Welche Antworten kann oder muss die Geschichte anbieten? Die Übung versucht sich diesen Antworten über drei Zugänge zu nähern: die Geschichte der Türkei mit Schwerpunkt auf raumspezifische und soziokulturelle Aspekte; eine Feinanalyse der rezenten Diskussionen sowie eine überblickende Historisierung der Debatten. Letzteres bietet sich an – denn was bedeutet es für die Debatte wenn sie scheinbar schon seit Jahrhunderten geführt wird? In der Übung werden Texte diskutiert, die sowohl aus der Debatte selbst stammen als auch Quellen und historiographische Texte, die uns einen historischen Hintergrund erschließen sollen.
Literatur:
Carnevale, R., Ihrig, S.; Weiß, C.: Europa am Bosporus (er-)finden? Die Diskussion um den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union in den britischen, deutschen, französischen und italienischen Zeitungen. Eine Presseanalyse. Frankfurt a. M. 2005; Walter, Jochen: Die Türkei - 'Das Ding auf der Schwelle'. (De-)Konstruktionen der Grenzen Europas. Wiesbaden 2008; Ihrig, Stefan: Talking Turkey, talking Europe - Turkey’s place in the common quest for defining Europe between imagining EU-Europe, the Orient and the Balkans. Insight Turkey 3/10 (Ankara, 2006), 28-36; Leggewie, Claus (ed.): Die Türkei und Europa - Die Positionen. Frankfurt a. M. 2004.
Hinweise:
Kenntnisse des Türkischen sind nicht erforderlich.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Thesenpapier und Kurzreferat (Diskussionsbeitrag).
Aktuelle Mitteilung: Zeitänderung: Die Übung wird Mi 8-10 stattfinden. Anmeldungen sind weiterhin möglich!
Südosteuropa zwischen Hitler und Mussolini - Visionen, Strategien und Herrschaft
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 209
Zeit:
Do 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ALFI 017
Welche Rolle spielte Südosteuropa für die Nationalsozialisten und die Faschisten? Und was bedeuteten die Pläne und die Besatzung der Region für die Region? Der italienische Faschismus begann sich bereits früh für Südosteuropa zu interessieren; Hitler betonte lange Zeit und oft Deutschlands Desinteresse. Die Übung wird sich der nationalsozialistischen und faschistischen Imagination in Bezug auf Südosteuropa sowie der späteren Besetzung und Besatzung nähern und damit die Region in die gesamteuropäische Perspektive einordnen. Wir werden uns sowohl mit Primärtexten, historiographischen Abhandlungen als auch mit anderen, literarischen Umsetzungen beschäftigen. Indem wir uns durch das Dickicht der Faschismusforschung eine Bresche schlagen, soll sowohl die Geschichtsschreibung als auch die Quellenlage erkundet werden.
Literatur:
Kallis, Aristotle A.: Fascist Ideology - Territory and Expansionism in Italy and Germany, 1922-1945. London 2000; Mazower, Mark: Hitler's Empire - Nazi Rule in Occupied Europe. London 2008; Rodogno, Davide: Fascism's European Empire - Italian Occupation During the Second World War. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006; Louis de Bernières: Corellis Mandoline. Frankfurt 1998 [Roman; „leichte“ Einstiegslektüre].
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Bibliographie und Kurzreferat
Studienexkursion: Der Zweite Weltkrieg und die Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Geschichte und Erinnerung
Veranstaltungstyp:
Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 210
Zeit:
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
22.-29.05.2010
Raum:
Im Versuch, die Gewalteskalation der 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien zu verstehen, nimmt die Exkursion die Schnittstelle zwischen Geschichte und Erinnerung des Zweiten Weltkrieges und der Kriege der 1990er Jahre in den Blick. Die Exkursion führt zu Orten, an denen sich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auf jugoslawischem Boden bzw. an den Krieg 1992-95 manifestieren und anhaltend kontrovers diskutiert werden – wie Srebrenica und Sutjeska, Omarska und Gorazde in Bosnien-Herzegowina, aber auch Jasenovac in Kroatien. Unsere 8-tägige Reise durch Bosnien-Herzegowina hält Gespräche mit WissenschaftlerInnen aus der Region, mit Vertretern von NGOs, mit Überlebenden- und Opfervereinigungen bereit, sowie auch die aktive Auseinandersetzung mit den materiellen Spuren der Erinnerung, wie Denkmälern, Gedenkstätten und Museen.
Literatur:
Hinweise:
Teilnahmevoraussetzung: Teilnahme am gleichnamigen Hauptseminar
Anmeldung:
Die Höchstteilnehmerzahl (25) ist bereits erreicht, so dass weitere Anmeldungen momentan nur noch für die Warteliste angenommen werden können. Kontakt: heike.karge@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
- 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Erfolg und Tragödie - Russlands Modernisierung seit Peter dem Großen
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 211
Zeit:
Freitag und Samstag, 9-17
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Termine:
23.-24.4. und 25.-26.6.2010
Raum:
- 23.04.2010: WIOS 309
- 24.04.2010: W 112
- 25.06.2010: WIOS 017
- 26.06.2010: W 112
Russischkenntnisse werden begrüßt, sind aber keine Voraussetzung.
Unter dem russischen Staatsoberhaupt Dmitrij Medvedev hat eine Modernisierungsdebatte in Russland begonnen, wie sie das Land schon seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Dabei handelt es sich nicht nur um eine neue wirtschaftliche Ausrichtung, sondern, so Dmitrij Medvedev, ums Überleben Russlands.
Denn das Land ist unzufrieden mit den Ergebnissen der Transformation, die mit der Perestrojka unter Michail Gorbatschov Mitte der achtziger Jahre begann und die seine Nachfolgern zum Teil fortgesetzt, zum Teil gebremst haben. Weder wirtschaftlich noch politisch ist in Russland eine nachhaltige Modernisierung gelungen. Vielleicht, weil der Kollaps des sowjetischen Imperiums nicht mehr zuließ.
Oder waren es Faktoren, die in Russland seit Jahrhunderten nicht beachtet wurden oder absichtlich ignoriert: die Weite des Landes, Russland ist das größte Land der Erde mit elf Zeitzonen; das bis heute ungeklärte Verhältnis von Staat und Privateigentum; der Missklang von Wissenschaft und Wirtschaft. Zwar gelang es der Sowjetunion den Kosmos zu erobern, doch scheiterte der Versuch einer erfolgreichen Leichtindustrie.
Lassen sich nun historische Parallelen herstellen zwischen ganz unterschiedlichen Programmen zu ganz unterschiedlichen Zeiten? Was gab den Ausschlag für tiefgreifende Reformen, und wie nachhaltig gerieten sie? Kamen diese Initiativen immer vom Staat, so wie es häufig in Russland dargestellt wird, oder hatten einige auch ihren Ursprung in der Gesellschaft?
In der Übung sollen unterschiedlichen Formen und Erfolge der Modernisierung seit Peter dem Großen diskutiert werden. Dazu gehören technische, wissenschaftliche sowie politische Reformen unter den Zaren Alexander II. und Nikolaus II. sowie unter den kommunistischen Generalsekretären bis zu Michail Gorbatschov sowie unter den russischen Präsidenten Boris Jelzin, Vladimir Putin und Dmitrij Medvedev.
Literatur:
- Bialer, Severyn (Hrsg.): Inside Gorbatchev’ Russia, Boulder 1989
- Billington, James: The Icon and the Axe, New York 1970
- Dixon, Simon: The Modernization of Russia, Cambridge 1999
- Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion, München 1998
- Hoskings, Geoffrey: Russia, People and Empire, Harvard 2001
- Kaiser, Robert: Why Gorbatchev happened, New York 1991
- Pipes, Richard: Russia under the Old Regime, London 1995
- Raeff, Marc: Plans for Political Reforms in Imperial Russia, Englewood Cliffs 1966
- Shevtsova, Lilia: Lost in Transition, Washington D.C. 2007
- Torke, Hans-Joachim: Lexikon der Geschichte Russlands, München 1985
- Stöckl, Günther: Russische Geschichte, Stuttgart 1983
- Ulam, Adam: The Bolsheviks, Cambridge 1998
Anmeldung:
Anmeldung bitte an die email-Adresse Reinhard-Krumm@t-online.de
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Mündliches und schriftliches Referat
Kollaboration in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges. Geschichte, Nachwirken und Aufarbeitung.
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 212
Zeit:
Do 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PT 1.0.6 (1. Veranstaltung) (Raumänderung!); z.T. auch im Stadtarchiv Regensburg/Kapelle
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende (MA, LA, BA) der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte sowie der deutschen Zeitgeschichte. Kenntnisse osteuropäischer Sprachen sind nicht erforderlich.
Während des Zweiten Weltkrieges trugen mehrere Millionen ausländische Soldaten deutsche Uniformen. Auch sie gerieten an vielen Fronten in die Gefangenschaft alliierter Streitkräfte. In der Übung sollen die Hintergründe für die Indienstnahme dieser "Hilfswilligen", die Motivation für ihre Kollaboration sowie die Folgen besprochen werden. Anhand von themenbezogenen Archivalien werden quellenkritische Betrachtung, Akten- und Archivkunde, Palleographie sowie Genealogie eingeübt.
Literatur:
S.I. Drobiazko (u.a.), Inostrannye formirovanija Tret'ego rejcha, Moskva 2009; R.-D. Müller, An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" 1941-1945, Berlin 2009; J.W. Gdañski, Zapomniani ¿o³nierze Hitlera, Warszawa 2005; A. Hoffmann, Die Tragödie der "Russischen Befreiungsarmee", neue Aufl., München 2003; A. Munoz, O.V. Romanko, Hitler's White Russians, New York 2003; K.A. Zalesskij, Kto byl' kto vo vtoroj mirovoj vojne. Sojuzniki Germanii, Moskva 2003; A. Anders, Russian volunteers in Hitler's army, New York 1996.
Anmeldung:
Telefonsich 0941 507 3454, per E-Mail: smolorzr@gmx.de
oder über den Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas, Vorzimmer (PT 4.1.13), Frau Rosemarie Scheid
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Kurzreferat, abschließende Klausur
Die bayerisch-tschechoslowakische Grenze im Kalten Krieg: Besichtigung des Grenzraums zwischen Furth im Wald und Hof - Geschichte, Geographie, grenzüberschreitende Kontakte
Veranstaltungstyp:
Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33
Zeit:
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
13.05. - 15.05.2010
Raum:
Informations- und Einführungsveranstaltung am 11.Mai 2010 (Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben)
Nahezu 45 Jahre bildete der Eiserne Vorhang an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze ein undurchdringliches Hindernis, das langfristige Folgewirkungen auf das Leben der dortigen Bevölkerung nahm. Insbesondere die Errichtung eines mehreren Kilometer breiten Sperrgebiets auf der östlichen Seite führte durch großangelegte Umsiedlungsaktionen und den Abriss ganzer Ortschaften zum Verlust zahlreicher Kulturdenkmäler und über Jahrhunderte gewachsener Strukturen. Im Zentrum der Exkursion soll daher der Versuch stehen, durch Ortsbesichtigungen die gemeinsame Geschichte des Grenzraums zu erschließen und die Folgen der Teilung zu analysieren. Gemeinsam mit tschechischen Studenten der Westböhmischen Universität Pilsen werden wir im Verlauf der 3-tägigen Exkursion Museen und Gedenkstätten beiderseits der Grenze besuchen und uns im Raum zwischen Furth im Wald und Hof auf die Suche nach Relikten des Eisernen Vorhangs begeben. Zu den Besichtigungsorten gehören unter anderem eine ehemalige Nato-Anlage auf dem Hohen Bogen bei Cham, verschiedene Denkmäler und Museen, sowie die historische Burganlage Stary Herstejn. Endpunkt der Exkursion ist die Gedenkstätte zur Geschichte der deutschen Teilung in Mödlareuth bei Hof, welche anhand originalgetreu erhaltener Sperranlagen den Aufbau des Eisernen Vorhangs zeigt.
Literatur:
Hinweise:
Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen
Anmeldung:
Anmeldung bitte bis zum 23.April 2010 unter markus.meinke@geschichte.uni-regensburg.de oder persönlich in Zimmer PT 3.1.88.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
- 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Kolloquium
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Forschungskolloquium "Neue Perspektiven der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte"
Veranstaltungstyp:
Kolloquium
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 217
Zeit:
Fr 14-19
Dauer:
Turnus:
monatlich
Beginn:
30.04.2010
Raum:
WIOS 017
Folgende Vorträge finden statt:
30.4.2010:
Christiane Brenner: "Zwischen Ost und West". Diskursanalytische Überlegungen zur tschechoslowakischen Volksdemokratie 1945-1948;
Luminita Gatejel: Warten, hoffen und endlich fahren. Auto und Sozialismus in der DDR, der Sowjetunion und Rumänien (1956-1980);
Wendy Lower: Biographies of Violence: Twentieth Century Ukraine, Two Germanys and Austria;
20.05.2010 um 18 Uhr:
Larry Wolff (New York)
21.05.2010:
Dubravka Stojanovic: Future Needs of Serbian Historiography;
Éva Kovács: Schwarze Körper, weiße Körper - Der koloniale Blick? "Zigeuner-Darstellungen" der Moderne;
Markus Meinke: Die Sperrmaßnahmen der DDR und der CSSR an der Landesgrenze zu Bayern, 1945 bis 1990;
16.07.2010:
Claudia Kraft: Biopolitik und Herrschaft im Staatssozialismus;
Paulina Bren: Tuzex, the Hustler, and the T-Girl: Hard Currency Shopping in socialist Czechoslovakia;
Bastian Vergnon: Die bayerische SPD und die sudetendeutschen Sozialdemokraten 1945 bis 1978
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Grundkurs
in Neuerer und Neuester
Geschichte
Deutsche Geschichte 1495-1618/20
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 222
Zeit:
Di 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
CHE 13.0.82
Der Grundkurs zur Deutschen Geschichte 1495–1618/20 dient dem Erwerb grundlegender faktengeschichtlicher Kenntnisse, die durch einen kritischen Einblick in Deutungskonzepte und Forschungskontroversen der hier verhandelten Periode ergänzt werden. Markierte der Wormser Reichstag von 1495 vor allem in verfassungsgeschichtlicher Hinsicht ein zentrales Scharnier politischer „Verdichtungsprozesse“, die als ein Signum der Zeit gewertet werden können, so definiert der Ausbruch des 30jährigen Krieges 1618/20 in seiner Verschränkung theologischer und säkularer Facetten eine zweite Grundstruktur des „langen“ 16. Jahrhunderts – eines Jahrhunderts, welches durch ein „ein Übermaß an Veränderung“ (W. Schulze) geprägt scheint.
Der Kurs versucht, Grundstrukturen und Entwicklungstendenzen des 16. Jahrhunderts anhand einzelner „Knotenpunkte“ plastisch werden zu lassen, welche hinsichtlich ihrer Genese und ihren Konsequenzen als Beispiele für die Komplexität des hier verhandelten Zeitraums gelten können; „Grundformen politischer Ordnung“ – „Reformation“ – „Religionsfrieden“ – „Konfessionelles Zeitalter“ – „30jähriger Krieg“ bilden demzufolge einen thematischen Raster, anhand dessen der Versuch unternommen wird, ein „langes“ Jahrhundert in einem „kurzen“ Semester zu erfassen.
Literatur:
GOTTHARD, Axel: Das Alte Reich 1495-1806 (Geschichte kompakt), Darmstadt 2. Aufl. 2005; HECKEL, Martin: Deutschland im konfessionellen Zeitalter (Deutsche Geschichte, Bd. 5), Göttingen 2. Aufl. 2001; RABE, Horst: Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500-1600 (Neue Deutsche Geschichte, Bd. 4), München 1989; SCHILLING, Heinz: Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648 (Siedler Deutsche Geschichte, Bd. 5), Berlin 1988; SCHULZE, Winfried: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert (1500-1618), Frankfurt/M. 1987.
Hinweise:
Weiterführende Literatur wird im Rahmen des Seminars bekanntgegeben.
Anmeldung:
Online über RKS (14.4.2010, 10.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
05.3 - 06.4 - 07.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
Leistungspunkte:
3
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, Klausur.
Vorlesung
in Bayerischer
Geschichte
Geschichte Bayerns im Hochmittelalter. Von den Karolingern zu den Welfen
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 125
Zeit:
Di 9-10, Mi 9-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
H 3 (Di) u. H 4 (Mi) (Raumänderung!)
Die Vorlesung beschäftigt sich mit dem Zeitraum von der Mitte des 10. Jh. bis zur Mitte des 13. Jh. Behandelt werden die politische Geschichte Bayerns, die Entwicklung von "Staat", Gesellschaft, Kirche und Wirtschaft sowie die Entfaltung des geistigen Lebens. Im Bereich der politischen Geschichte liegt der Schwerpunkt auf dem Verhältnis Bayerns zum Reich, dem Konflikt Welfen-Staufer-Babenberger und der Etablierung der wittelsbachischen Herrschaft im 13. Jh.
Literatur:
SPINDLER, M. (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 2, München 2. Aufl. 1988; DERS., Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums, München 1937; H. GLASER (Hg.); Wittelsbach und Bayern (Ausstellungskatalog) Bd. I,1, München 1980; A. KRAUS, Geschichte Bayerns, München 3. Aufl. 2004.
Hinweise:
Eine ausführliche Literaturliste wird zu Beginn des Semesters im Internet zur Verfügung gestellt. Für Teilnehmer ohne Internetzugang liegen Literaturlisten zum Kopieren im Sekretariat bereit.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
04.3 - 06.1 - 07.2 - 13.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
04.3 - 11.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung: Klausur
Hauptseminar
in Bayerischer
Geschichte
Bayern im Umbruch. Vom Kurfürstentum zum Königreich Bayern
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 138
Zeit:
Mo 15-17
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Das Hauptseminar behandelt die Zeit vom Regierungsantritt Kurfürst Karl Theodors bis zum Tod König Maximilians I. In diesem Zeitraum vollzieht sich ein großer Umbruch in der deutschen Geschichte, der zu einer gebiets- und verfassungsmäßigen Neuordnung Deutschlands und zum Abbau der aus dem Mittelalter überkommenen Institutionen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft führte. Es soll untersucht werden, welche Rolle Bayern im Rahmen dieser Entwicklung spielte und welche Veränderungen in Bayern vonstatten gingen, die Bayern am Ende des behandelten Zeitraums zu einem der modernsten Staaten in Deutschland machte.
Literatur:
SPINDLER, M. (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. IV, 1, 1974; DERS.: Der neue Staat Montgelas' und Ludwigs I., in: Unbekanntes Bayern, Bd. 8, 1964, S. 210-219; ARETIN, K. O. Frhr. v.: Heiliges Römisches Reich 1776-1802, 2 Bde., 1967; WEISS, E.; Montgelas, 1971.
Anmeldung:
Persönliche Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung und Vergabe der Referatsthemen am Donnerstag, den 11. Februar 2010, 11-12 Uhr im Zimmer PT 3.1.44.
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 13.1 - 14.1
GES-M
11.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Referat und Hausarbeit
Oberseminar
in Bayerischer
Geschichte
Oberseminar für Doktoranden, Magistranden und Bearbeiter von Zulassungsarbeiten
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 145
Zeit:
Do 8.30-11.00
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ZH 8
Bearbeiter von Dissertationen, Magister- und Zulassungsarbeiten erhalten Gelegenheit, ihre Themen vorzustellen und sich ergebene Probleme in einem größeren Kreis zu erörtern. Gemeinsam werden Fragen methodischer und konzeptioneller Art besprochen sowie Aspekte der Quellenkritik und Quellenauswertung behandelt.
Literatur:
Hinweise:
Es wird erwartet, dass alle teilnehmen, die bei mir eine Abschlussarbeit schreiben.
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Übungen
in Bayerischer
Geschichte
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 191
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
Montag, 26.04.2010
Raum:
PT 2.0.9
In Begleitung zur Vorlesung werden wichtige Quellentexte zu zentralen Fragen und Problemfeldern des agilolfingischen Bayern interpretiert. Dabei werden in methodischer Hinsicht Aussagen und Thesen, die in der Literatur vertreten werden, auf ihre quellenmäßige Fundierung überprüft.
Literatur:
AY, K.L. (Bearb.): Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800, München 1974 (Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern, I,1); SPINDLER, M.: Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 1: Das alte Bayern. Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts, München, 2. Auflage 1981.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43).
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung: regelmäßige Teilnahme, Klausur.
Geschichte als Argument – das Spannungsverhältnis zwischen bayerischer Landesgeschichte und Politik im 19. und 20. Jahrhundert (mit Exkursionen)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 192
Zeit:
Do 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ZH 1
Im Rahmen dieser Übung soll dem Spannungsverhältnis zwischen Politik und Wissenschaft in Bayern nachgegangen werden, d.h. der staatlichen Förderung der Erforschung der Geschichte Bayerns mit all den damit oftmals von der Politik beabsichtigten Forderungen und Erwartungen an die bayerische Landesgeschichte auf der einen Seite und dem Anspruch der wissenschaftlichen Freiheit und dem Ringen um die möglichst objektive Rekonstruktion und Schilderung historischer Sachverhalte durch die Repräsentanten der akademischen bayerischen Landesgeschichte auf der anderen Seite.
Schwerpunktmäßig sollen hierbei markante Stationen in der Entwicklung der Landesgeschichte auf die damit verbundenen Absichten und Hoffnungen (sowohl von politischer wie von wissenschaftlicher Seite) untersucht werden: etwa die Gründung der „Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften“ (1858), die Errichtung eines ersten Lehrstuhls für bayerische Landesgeschichte in München (1898), die Gründung der „Kommission für bayerische Landesgeschichte“ (1927), die Institutionalisierung des Instituts für Bayerische Geschichte an der Universität München (1947), die Festschreibung der bayerischen Geschichte im Kanon der Lehrerausbildung wie in den Lehrplänen nach 1945, die Gründung des „Hauses der Bayerischen Geschichte“ im Jahr 1983 oder das von Ministerpräsident Seehofer unlängst angedachte „Museum der bayerischen Geschichte“. Umgekehrt soll aber auch der durch die jeweilige Veränderungen und Neuorientierungen der bayerischen Politik (z.B. nach 1866, aufgrund der Reichsgründung, nach 1918, zwischen 1933 und 1945 oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg) feststellbare Niederschlag in den Standardwerken zur bayerischen Geschichte analysiert und untersucht werden.
Literatur:
SPINDLER, Max: Erbe und Verpflichtung. Aufsätze und Vorträge zur Bayerischen Geschichte, München 1966; VOLKERT, Wilhelm / ZIEGLER, Walter (Hg.): Im Dienst der bayerischen Geschichte. 70 Jahre Kommission für bayerische Landesgeschichte. 50 Jahre Institut für Bayerische Geschichte, 2. Aufl., München 1999 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 111); VOLLHARDT, Ulla-Britta: Geschichtspolitik im Freistaat Bayern. Das Haus der Bayerischen Geschichte: Idee – Debatte – Institutionalisierung, München 2003 (Münchner Geschichtsdidaktisches Kolloquium 5).
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43).
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3 - 14.3 - 15.5
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung: Leistungsnachweis in Form eines Referats oder einer mündlichen Prüfung
Aufgaben und Möglichkeiten der Bayerischen Landesgeschichte im Schulunterricht
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 193
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
H 12 (Raumänderung!)
Von Lehrer- wie Schülerseite hört man immer wieder, dass Schüler durch historische Themen und Sachverhalte mit lokalem oder regionalem Bezug viel eher für den Geschichtsunterricht zu begeistern sind als sonst. Und obwohl dies so wahrgenommen wird und obwohl in den Lehrplänen zu allen bayerischen Schularten sich über die Jahrgangsstufen verteilt Inhalte zur Regional- und Landesgeschichte finden, spielen diese im Schulalltag eine eher untergeordnete Rolle. Ein Grund dürfte das Fehlen von geeigneten Lehrbüchern und Unterrichtsmaterialien für die verschiedenen Regionen zur Unterrichtsvorbereitung sein.
Im Rahmen dieser Übung sollen die Vorgaben und Chancen, die der Lehrplan im Bezug auf landes- und regionalgeschichtliche Themen bietet, analysiert und diskutiert werden. Darüber hinaus soll nach weitergehenden und alternativen Möglichkeiten gesucht werden, wie die Landes- und Regionalgeschichte im Schulunterricht gestärkt und deutlicher positioniert werden kann.
Literatur:
Die Beiträge von Ferdinand KRAMER, Wolfgang PLEDL, Walter ZIEGLER und
Helmut BEILNER, in: Waltraud SCHREIBER (Hg.): Erste Begegnungen mit
Geschichte. Grundlagen historischen Lernens, Bd. 1, 2. Aufl. Neuried
2004 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik 1). Hans-Michael
KÖRNER: Die bayerische Geschichte am Gymnasium. Zum Profil des
Geschichtsunterrichts in Bayern im 19. und 20. Jahrhundert, in: Neuere
Ansätze zur Erforschung der neueren bayerischen Geschichte.
Werkstattberichte, hg. von Katharina WEIGAND und Guido TREFFLER,
Neuried 1999 (Münchener Kontaktstudium Geschichte 2), S. 11-29.
Die bayerischen Lehrpläne sind im Internet abrufbar unter: http://www.isb.bayern.de/
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Klausur oder mündliche Prüfung
Aspekte der Regensburger Stadtgeschichte
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 194
Zeit:
Mi 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Die Übung soll Studierende mit der Geschichte der Stadt Regensburg anhand deren wichtigster baulicher Zeugen vertraut machen. Dazu werden einzelne Aspekte mit Hilfe bestimmter Gebäude näher betrachtet und vor Ort vertieft. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch sonst nicht öffentlich zugängliche Bauwerke besichtigt.
Literatur:
BAUER, K.: Regensburg, 5. Aufl., Regensburg 1997; BORGMEYER, A. u. a.: Stadt Regensburg (Denkmäler in Bayern III.37); FREITAG, M.: Kleine Regensburger Stadtgeschichte, Regensburg 1999; SCHMID, P. (Hg.): Geschichte der Stadt Regensburg, 2 Bände, Regensburg 2000.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3 - 14.3 - 15.5
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat, Klausur
Quelleneditionen zur Geschichte Bayerns in der Neuzeit
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 195
Zeit:
Mo 8.30-10 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 3.0.60 (Raumänderung!)
Die Übung soll einen Überblick über die wichtigsten Quelleneditionen zur bayerischen Geschichte in der Neuzeit verschaffen. Dazu werden zunächst die Merkmale und die Bedeutung von wissenschaftlichen Quelleneditionen vorgestellt, dann entsprechende Werke zur bayerischen Geschichte in Form von Referaten präsentiert. Dabei soll versucht werden, die vorhandenen Quelleneditionen systematisch zusammenzustellen, dadurch in Ansätzen eine bayerische Quellenkunde vorzubereiten.
Literatur:
Winfried BAUMGART (Hg.): Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur Gegenwart, 7 Bde., Darmstadt 1982-2003.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - ist notwendig und ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit.
Die dem „Churfrten. Markt Abach gnädigt ertheilten Freyheithen“ von 1733. Quellenübung zum Marktrecht in Bayern
(Veranstaltung auch im Rahmen der EDV-Ergänzungsausbildung)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung - EDV-Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 196
Zeit:
Mo 12-14 (Terminänderung!) (wöchentlich) u. Mo 15-17 (14-täglich)
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich (Geschichte-Übung) u. 14-täglich (EDV-Teil)
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 3.0.60 (Raumänderung!) u. CIP-Pool PT 2.0.2
Die Übung soll einen Beitrag leisten zur Edition einer handschriftlichen archivalischen Quelle aus dem 18. Jahrhundert: des Marktrechts von (Bad) Abbach, das der damalige bayerische Kurfürst Karl Albrecht 1733 den Bürgern von Abbach bestätigte. Dabei sollen auch allgemeine Kenntnisse über das Marktrecht in Bayern gewonnen werden.
Die Teilnehmer der Übung sollen also einen Teil der genannten Quelle transkribieren, ihren Inhalt nach wissenschaftlichen Kriterien erschließen und darüber hinaus die erstellte Edition für eine Publikation im Internet vorbereiten. Einen Bestandteil der Übung wird deshalb eine Einführung in die Erstellung von Web-Seiten mit HTML bilden. Grundkenntnisse in EDV und Paläographie sind hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.
Literatur:
Zur Erstellung von Web-Seiten siehe die Einführung in HTML von Stefan Münz unter der Adresse:
http://de.selfhtml.org/.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - ist notwendig und ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2 - 05.3 - 07.3
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige und aktive Teilnahme, Lesen und Interpretation von archivalischen Quellen, Erstellen einer Online-Edition einer archivalischen Quelle im Rahmen einer Seminararbeit.
Einführung in die Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft am Beispiel der bayerischen Landesgeschichte
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 197
Zeit:
Mi 11-13
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
H 42 (Raumänderung!)
Die Veranstaltung ist auch für Studierende des Lehramts Gymnasium gedacht, die einen Theorie- und Methodenschein nach LPO I § 71 (1) 2. c) (alte Ordnung) benötigen.
In dieser Übung soll eine eigene Disziplin innerhalb der Geschichtswissenschaft untersucht werden: die Landesgeschichte. Dabei werden zunächst die Merkmale dieser Disziplin zusammengestellt, ferner wird die Entstehung einer institutionalisierten Landesgeschichtsschreibung in Bayern verfolgt. Es werden wichtige bayerische Historiker und ihre Werke vorgestellt, die Institutionen, die sich mit der Erforschung der bayerischen Geschichte befassen, Publikationsorgane und ihre Entwicklung, größere Forschungsprojekte und auch neuere Versuche, die Arbeit der bayerischen Landeshistoriker mittels moderner Medien, wie dem Internet, zu koordinieren. Schließlich werden die Darstellungen ausgewählter historischer Ereignisse und Entwicklungen aus der bayerischen Geschichte aus dem Blickwinkel verschiedener Historiker aus mehreren Epochen verfolgt und verglichen, um die Problematik der Objektivität der Geschichtsschreibung vor Augen zu führen.
Literatur:
VOLKERT, Wilhelm - ZIEGLER, Walter (Hgg.): Im Dienst der bayerischen Geschichte. 70 Jahre Kommission für bayerische Landesgeschichte. 50 Jahre Institut für Bayerische Geschichte (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Bd. 111), München 2. Aufl. 1999.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - ist notwendig und ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier.
Jahre des stillen Wandels. Regensburg zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. Übung zur Vorbereitung einer Ausstellung zu Regensburger Ansichtskarten
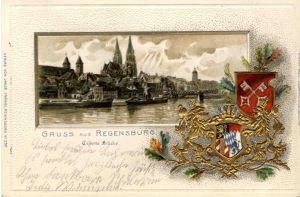 Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Projektübung
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Projektübung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 198
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
21.4.2010
Raum:
Staatliche Bibliothek Regensburg (Gesandtenstr. 13, 93047 Regensburg)
Die Veranstaltung findet teilweise als Blockveranstaltung statt. Die Teilnehmer sollen sich deshalb den Mittwoch-Nachmittag ab 14 Uhr für die Übung freihalten.
In der Übung werden auch Exkursionen im Stadtbereich zu den Motiven der Ansichtskarten abgehalten.
Es waren Jahre des behutsamen Wandels, welche das damals sehr provinzielle Regensburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägten. Zwar wuchs die Stadt, doch sehr verhalten.
In dieser Lehrveranstaltung soll das damalige Regensburg anhand von zeitgenössischen Ansichtskarten beleuchtet werden. Die Abbildungen vermitteln überwiegend den Eindruck eines Idylls. Doch das alltägliche Leben in der Stadt war oftmals alles anderes als idyllisch. Viele Zeitgenossen bemerkten, wie schlecht die Lebensbedingungen waren, die sich etwa in der erschreckend hohen Kindersterblichkeit widerspiegelten.
Im Rahmen der Lehrveranstaltung soll eine Ausstellung zu diesen Regensburger Ansichtskarten sowie ein kleines Begleitbuch dazu erarbeitet werden.
Literatur:
BAUER, Karl: Regensburg. Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte, Regensburg, 5. Aufl. 1997.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - ist notwendig und ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.4 - 07.4
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Referat, Mitwirkung an der Erarbeitung der Ausstellung, Beitrag zu dem geplanten Begleitbuch zur Ausstellung.
Übung zu Staatsexamenthemen aus der Bayerischen Geschichte
Veranstaltungstyp:
Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 199
Zeit:
Do 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
CHE 12.0.19 (Raumänderung!)
Die Übung soll der Vorbereitung auf das schriftliche Staatsexamen (Geschichte vertieft/nicht vertieft) dienen. Anhand von Klausurfragen zur mittelalterlichen, zur neueren und zur neuesten Geschichte Bayerns wird die Erschließung und sinnvolle Gliederung von Themen geübt. Die Teilnehmer sollen - einzeln oder in kleinen Gruppen - Gliederungen ausarbeiten, die in den Übungsstunden besprochen werden.
Eine Zusammenstellung von Themen aus der Bayerischen Geschichte in den Staatsexamensklausuren seit Frühjahr 1992, Themenvorschläge für den Examenskurs und eine Literaturliste zur Bayerischen Geschichte können demnächst auf einer eigenen Homepage zur Übung abgerufen werden. Die Teilnehmer sollten möglichst bereits vor Semesterbeginn ein Thema aus den Themenvorschlägen auf der Homepage wählen, das sie in der Übung vorstellen wollen, und es per Mail mitteilen an: g.koeglmeier@gmail.com
Literatur:
SPINDLER, Max/KRAUS, Andreas/SCHMID, Alois (Hgg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 1, 2. Aufl., München 1981; Bd. 2, 2. Aufl., München 1988; Bd. 4/I, 2. Aufl., München 2003; TREML, Manfred (Hg.): Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistaat, 3. Aufl., München 2006.
- Bayerische Staatsexamensfragen in Geschichte im Internet:
Hinweise:
Dies ist eine freiwillige Veranstaltung, in der kein Schein und keine Leistungspunkte erworben werden können.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://Anmeldung-Koeglmeier.ist-im-netz.de - wird erbeten und ist ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
0
Leistungsanforderungen:
Kriminalität und Rechtspraxis in Niederbayern im 19. Jahrhundert anhand ausgewählter Ermittlungsakten
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 200
Zeit:
Mi 8-10 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
H 45
Anhand ausgewählter Ermittlungsakten des im Staatsarchiv Landshut lagernden Bestandes "Landgericht älterer Ordnung Dingolfing" aus dem 19. Jahrhundert, die im Kurs auszugsweise zusammen gelesen werden, werden damals aktuelle Kriminalfälle unterschiedlichster Vergehen (Diebstahl, Raub, Mord, Kindstötung, Notzucht, usw.) untersucht und die damals gängige Rechtspraxis näher beleuchtet.
Zugleich werden in der Übung Paläographiekenntnisse vermittelt.
Literatur:
HEYDENREUTER, Reinhard, Kriminalgeschichte Bayerns. Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, Regensburg 2008.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Peter Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
- 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme und Abschlussklausur
Herzog Albrecht IV. von Bayern (1465-1508) - wittelsbachische Herrschaftskonzeption zwischen Landesteilung und Landeseinheit
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 201
Zeit:
Mi 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ZH 1
In krassem Gegensatz zum Herzogtum Bayern-Landshut, das in über hundert Jahren in jeder Generation nur einen männlichen Erben hatte und dadurch eine enorme herrschaftspolitische Stabilität aufwies, herrschte in Bayern-München um die Mitte des 15. Jahrhunderts gleichsam ein Überangebot. Fünf Söhne gingen aus der Ehe Albrechts III. mit Anna von Braunschweig hervor, darunter auch Herzog Albrecht IV. der Weise von Bayern, der nach der Epoche der Landesteilungen und dem Landshuter Erbfolgekrieg 1504/05 schließlich die Herrschaft über das wiedervereinigte bayerische Herzogtum antreten konnte. Als drittgeborener, für den geistlichen Stand bestimmter Herzogssohn der Linie Bayern-München sicherte sich Albrecht IV. in den Jahren 1463/65 zuerst die Mitregierung und schließlich 1467 die Alleinherrschaft über das Herzogtum Bayern-München. Doppelregierungen, ständige Konflikte mit seinen beiden jüngeren Brüdern Christoph und Wolfgang um Herrschaftsansprüche und die Dominanz der reichen und mächtigen Herzöge von Bayern-Landshut lähmten nicht nur die reichspolitische Schlagkraft Albrechts und des Herzogtums Bayern-München insgesamt. Die unsichere und ständigen Erschütterungen ausgesetzte Basis seiner Herrschaft veranlasste Albrecht IV. dazu, zielgerichtet die Herrschaftsansprüche seines Hauses zu legitimieren und weiter zu verankern. Die planmäßige Herrschaftskonzeption Albrechts IV. zwischen den angeführten Spannungsfeldern steht im Mittelpunkt der Übung. Eine genauere Untersuchung im Hinblick auf die angewandten Mittel und möglichen Vorbilder schließt auch eine Beschäftigung mit der Politik Bayern-Landshuts mit ein.
Literatur:
KRAUS, Andreas, Sammlung der Kräfte und Aufschwung (1450-1508), in: Max Spindler, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 2: Das Alte Bayern, Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, hg. von Andreas Kraus, München 21988, S. 288-321.
STAUBER, Reinhard, Die Herzöge von München. Die Wiederherstellung der Landeseinheit, in: Alois Schmid/Katharina Weigand (Hg.), Die Herrscher Bayerns. 25 historische Porträts von Tassilo III. bis Ludwig III., München 2001, S. 142-157.
LACKNER, Irmgard, Die Herzogshöfe in Landshut und München. Herzogliche Hofhaltung im Dienste der Repräsentation und Herrschaftslegitimierung, in: Franz Niehoff (Hg.), Ritterwelten im Spätmittelalter. Höfisch-ritterliche Kultur der Reichen Herzöge von Bayern-Landshut, Landshut 2009 (Schriften aus den Museen der Stadt Landshut 29), S. 23-31
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Peter Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
- 05.1 - 07.1
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Referat oder Klausur
Essen und Trinken in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 202
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.5
In der Übung werden anhand ausgesuchter zeitgenössischer Quellen die Ernährungs- und Konsumgewohnheiten der Menschen in Bayern untersucht. Basierend etwa auf Quellen zur Hofhaltung der reichen Herzöge von Bayern-Landshut aus dem 15. Jahrhundert oder zur Verpflegung der Bewohner des Landshuter Hl. Geistspitals aus dem 17. Jahrhundert sollen Studien ermöglicht werden, die nicht nur den Adel, sondern auch die Bürgerschaft in Bayern im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit umfassen. Zugleich werden in der Übung Paläographiekenntnisse vermittelt.
Literatur:
LARIOUX, Bruno, Tafelfreuden im Mittelalter. Kulturgeschichte des Essens und Trinkens in Bildern und Dokumenten, Stuttgart, Zürich 1992.
BEHRE, Karl-Ernst, Die Ernährung im Mittelalter, in: Bernd Herrmann/Klaus Arnold (Hg.), Mensch und Umwelt im Mittelalter, Frankfurt am Main 1989, S. 74-87.
DIRLMEIER, Ulf/FOUQUET, Gerhard, Ernährung und Konsumgewohnheiten im spätmittelalterlichen Deutschland, in: GWU 12 (1993) S. 504-526.
KÜHNE, Andreas: Essen und Trinken in Süddeutschland. Das Regensburger St. Katharinenspital in der Frühen Neuzeit, Regensburg 2006.
Hinweise:
Die Übung ist auch für Studierende der
Studiengänge
Deutsch-Französische Studien (B.A.), Deutsch-Spanische Studien (B.A.)
und Interkulturelle Europastudien (M.A.) zugänglich.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Peter Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
- 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme und Abschlussklausur
Übung zur Paläographie des 16. und 17. Jahrhunderts
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 203
Zeit:
Mo 18-20
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
ZH 1
In der Übung sollen vertiefte Kenntnisse über die deutsche Schrift des 16. und 17. Jahrhunderts vermittelt werden. Dazu werden Schriftstücke (Urkunden, Akten, Amtsbücher) mit unterschiedlichen Schrifttypen und paläographischen Schwierigkeiten gelesen und transkribiert.
In der Übung werden die gelesenen Texte unter sprachlichen, historischen, rechtlichen und volkskundlichen Aspekten interpretiert. Es werden überdies systematische Hinweise auf die notwendigen Hilfsmittel gegeben.
Der Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme muss durch eine Abschlussklausur erbracht werden.
Literatur:
STURM, H., Unsere Schrift. Eine Einführung in die Schriftkunde. Grundwissen Genealogie, Neustadt a.d. Aisch 2005; Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, hrsg. v. BECK F. - HENNING E., 4. Aufl., Köln - Weimar - Wien 2004
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Peter Schmid (PT 3.1.43)
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Klausur
Do ut des - Päpstliche Privilegien für bayerische Herzöge im 15. Jahrhundert
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 204
Zeit:
Mi 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ZH 8
Im ausgehenden Mittelalter war es für viele weltliche Herrschaftsträger ein probates Mittel, ihre Kirchen- und Klosterpolitik mit Hilfe päpstlicher Privilegien zu legitimieren und auf diese Weise die Rechte der eigentlich zuständigen kirchlichen Autoritäten wie etwa der Ortsbischöfe auszuhebeln. Dieser „Kurialismus“ kam im Laufe des 15. Jahrhunderts auch im deutschsprachigen Raum immer mehr in Mode. Zwar ist Deutschland am Vorabend der Reformation im Vergleich zu Frankreich oder Spanien als eher kurienfern zu bezeichnen, einige bedeutendere deutsche Territorialherren – darunter auch die Wittelsbacher – bemühten sich aber durchaus erfolgreich, von der „do ut des“-Politik der Renaissancepäpste in vielerlei Hinsicht zu profitieren.
Im Rahmen der Übung sollen anhand von ausgewählten Beispielen päpstlicher Privilegien für bayerische Herzöge aus dem 15. Jahrhundert zum einen Grundkenntnisse in lateinischer Paläographie und kurialer Diplomatik jener Zeit vermittelt werden, zum anderen sollen die Teilnehmer Einblick in ein bislang wenig beachtetes Kapitel bayerischer „Außenpolitik“ erhalten.
Literatur:
RANKL, H., Das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment in Bayern (1378-1526) (Miscellanea Bavarica Monacensia 34), München 1971, bes. S. 3-82; FRENZ, Th., Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 2), 2., aktualisierte Aufl., Stuttgart 2000; TEWES, G.-R., Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der Reformation (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 95), Tübingen 2001.
Hinweise:
Lateinkenntnisse erforderlich
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43).
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Klausur
Fürstengewalt und Stände, Herzog und Kaiser im Zeitalter der Reformation (1508-1579)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 205
Zeit:
Fr 12-14 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
H 7 (Raumänderung!)
Im 16. Jahrhundert stieg Bayern von einem mittleren Territorium zur katholischen Vormacht im Reich auf. Der Aufbau des frühmodernen Staates und die Bewahrung der inneren Religionseinheit – flankiert von einer insgesamt erfolgreichen Reichspolitik – waren maßgebliche Voraussetzungen für diese Entwicklung.
Die Übung soll inhaltlich in die bayerische und deutsche Geschichte des Reformationszeitalters einführen und gleichzeitig die methodischen Grundlagen für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit der Frühen Neuzeit vermitteln. Anhand von archivalischen und gedruckten Quellen wird der Umgang mit dem hilfswissenschaflichen „Handwerkszeug“ des Historikers eingeübt.
Literatur:
ZIEGLER, W. (Bearb.): Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern. Abt. I: Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800. Bd. 3, Teil 1: Altbayern von 1550-1661, München 1992; SPINDLER, M.: Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 2: Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, hg. v. A. Kraus, 2. Aufl. München 1988.
Anmeldung:
Anmeldung nicht erforderlich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat
Exkursionen zur Denkmalpflege in der Oberpfalz unter landesgeschichtlichen Aspekten
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 206
Zeit:
Di 13-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
Dienstag, 18.05.2010
Raum:
Weinschenk-Villa
Bezirksheimatpfleger Dr. Franz Xaver Scheuerer wird am Beispiel verschiedener Objekte vor Ort Probleme, Methoden und Ergebnisse moderner Denkmalpflege in der Oberpfalz behandeln.
Die Exkursionen werden an fünf Terminen durchgeführt:
25. Mai, 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni und 22. Juni.
Sie beginnen jeweils um 13.00 Uhr. Mit einer Dauer von ca. 5 Stunden ist zu rechnen. Die Veranstaltung möchte Kompetenzen im Bereich der Heimat- und Denkmalpflege anstreben oder ergänzend zu ihrem Studium eine zusätzliche Qualifikation erwerben wollen.
Eine Vorbesprechung mit näheren Informationen findet am Dienstag, 18.05.2010, in der Weinschenk-Villa, Hoppestraße 6, 93049 Regensburg um 14.30 Uhr statt.
Literatur:
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43).
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3 - 14.3 - 15.5
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat, Klausur
Grundkurse
in Bayerischer
Geschichte
Geschichte Bayerns von den Agilolfingern bis 1180
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 223
Zeit:
Do 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ZH 1
In diesem Grundkurs sollen die wichtigsten Ereignisse, Entwicklungen und Strukturen in der bayerischen Geschichte in der Zeit zwischen der Ausbildung eines bayerischen Stammesherzogtums zu Beginn des Mittelalters und der Verleihung der bayerischen Herzogswürde an Otto von Wittelsbach im Jahr 1180 näher betrachtet und dargestellt werden. Dabei stehen die folgenden fünf größeren Einheiten im Mittelpunkt: 1.) Das bayerischen Stammesherzogtums unter der Führung der agilolfingischen Herzogsfamilie (bis 788), 2.) Bayern im Karolingerreich (bis 911), 3.) Das jüngere bayerische Stammesherzogtum unter den Luitpoldingern, 4.) Bayern „im Dienste des Reiches“ unter den Ottonen und Saliern und 5.) Das „welfische Jahrhundert“ (1070-1180).
Literatur:
SPINDLER, Max (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 1: Das alte Bayern. Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts, 2. Aufl., München 1981; KRAUS, Andreas: Geschichte Bayern. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 3. Aufl., München 2004.
Anmeldung:
Anmeldung durch Listeneintrag im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Schmid (PT 3.1.43).
Modul/e:
GES-LA-M
04.1 - 06.4 - 07.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
04.1
Leistungspunkte:
3
Leistungsanforderungen:
(nur für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung) regelmäßige Teilnahme, Klausur
Bayerische Geschichte von 1180 bis 1506
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 224
Zeit:
Do 8.30-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
H 23
Der Grundkurs behandelt das Hoch- und Spätmittelalter in Bayern, den Zeitraum von der Übertragung der bayerischen Herzogswürde an den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach bis zum Ende der Aufteilung Bayerns in verschiedene Teilherzogtümer durch die Primogeniturordnung Herzog Albrechts IV. In dieser Epoche entwickelte sich Bayern zum Territorialstaat, es entstand ein Ständewesen, Bayern spielte durch das Kaisertum Ludwigs des Bayern eine über seine ursprüngliche Bedeutung weit hinausragende Rolle im Reich, die es nach einer Reihe von Teilungen und internen Kämpfen im 14. Jahrhundert aber bald wieder verlor.
Im Vordergrund der Betrachtung steht die politische Geschichte, die ergänzt wird durch eine eingehende Behandlung der Verfassungs-, Rechts- und Sozialgeschichte. Es sollen grundlegende Strukturen und Entwicklungen vermittelt, die entscheidenden Herrschaftsträger vorgestellt und zentrale Begriffe geklärt werden.
Literatur:
KRAUS, Andreas: Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, 3. Aufl. 2004. – SPINDLER, Max/KRAUS, Andreas (Hgg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 2, 3. Aufl., München 1988, §§ 1-44.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://Anmeldung-Koeglmeier.ist-im-netz.de - wird erbeten und ist ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.1 - 06.4 - 07.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
04.1
Leistungspunkte:
3
Leistungsanforderungen:
für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung: regelmäßige Teilnahme, Klausur;
für Studierende nach der alten LPO, der alten BA-Ordnung oder im Magisterstudiengang ist der Besuch eines Grundkurses freiwillig; für sie gibt es keine Leistungsanforderungen.
Bayerische Geschichte im 19. Jahrhundert
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 225
Zeit:
Do 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
H 22
In dem Grundkurs wird die bayerische Geschichte im sog. langen 19. Jahrhundert behandelt, d.h. die Zeit ab etwa 1800 bis 1918. Am Beginn des betrachteten Zeitraums entstand durch die Reformen Montgelas' im Innern und durch territoriale Gewinne das moderne Bayern. Das Kurfürstentum stieg auf zum Königreich. Als einer der ersten deutschen Staaten erhielt Bayern 1818 eine Verfassung mit einer Volksvertretung. Das dabei entstandene System der konstitutionellen Monarchie prägte das Land ein ganzes Jahrhundert lang. Einschnitte brachten die erzwungenen Reformen von 1848 und der Anschluss an das Deutsche Reich 1871. Am Ende des behandelten Geschichtsabschnitts stand der Umsturz vom November 1918, als der monarchische Staat dem auf revolutionärem Wege errichteten Freistaat weichen musste.
Den Schwerpunkt des Grundkurses nimmt die politische Geschichte ein. Aber auch die Verfassungs-, Rechts- und Sozialgeschichte werden behandelt. Es sollen vor allem grundlegende Strukturen und Entwicklungen vermittelt, wichtige Personen vorgestellt und zentrale Begriffe geklärt werden.
Literatur:
KRAUS, Andreas: Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1983; TREML, Manfred (Hg.): Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistaat, 3. Aufl., München 2006; SPINDLER, Max – KRAUS, Andreas – SCHMID, Alois (Hgg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 4/I, 2. Aufl., München 2003; Bd. 4/II, München 2007; BONK, Sigmund - SCHMID, Peter (Hg.): Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, Regensburg 2005.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - wird erbeten und ist ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.1 - 06.4 - 07.3 - 15.3 - 15.4 - 19.2
GES-M
04.1
Leistungspunkte:
3
Leistungsanforderungen:
für Studierende nach der neuen LPO oder der neuen BA-Ordnung: regelmäßige Teilnahme, Klausur;
für Studierende nach der alten LPO, der alten BA-Ordnung oder im Magisterstudiengang ist der Besuch eines Grundkurses freiwillig; für sie gibt es keine Leistungsanforderungen.
Vorlesung
in Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte
Geschichte Südosteuropas: Von der osmanischen Eroberung bis zur Europäischen Integration
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 126
Zeit:
Di 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
H 16
Diese Vorlesung soll die Grundzüge der südosteuropäischen Geschichte in der Neuzeit vermitteln und in die wichtigsten Forschungsansätze einführen. Ziel ist es, einerseits die Besonderheiten der Geschichte dieses Raumes herauszuarbeiten, andererseits aber vergleichende Dimension deutlich zu machen. Dabei wird auch thematisiert, wie und ob „Südosteuropa“ als Geschichtsregion definiert werden kann.
In der Vorlesung wird es nicht nur um die politische Geschichte gehen, sondern auch um die sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen seit dem Beginn der osmanischen Herrschaft. Auch alltagsgeschichtliche Fragestellungen – wie die Rolle der Religion sowie die Formen von Familie und Verwandtschaft – werden nicht zu kurz kommen; die geografischen Grundlagen der Geschichte werden ebenfalls erläutert. Damit führt die Vorlesung auch in zentrale Fragestellungen der historischen Anthropologie und Sozialgeschichte ein – mit Beispielen aus Südosteuropa.
Der zeitliche Fokus liegt auf der Periode der osmanischen Herrschaft sowie der Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert, wobei insbesondere Fragen der Nationsbildung, der kommunistischen Herrschaft und der sozioökonomischen Transformation erörtert werden.
Ausführliche Informationen und Studienunterlagen werden zeitnah im G.R.I.P.S zur Verfügung gestellt.
Literatur:
Literaturangaben werden vor Semesterbeginn auf der E-Learning-Plattform bekanntgegeben.
Anmeldung:
keine Anmeldung erforderlich
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Klausur
Aktueller Hinweis: Die Veranstaltung entfällt.
Russland und die Sowjetunion global 1851-1991
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 127
Zeit:
Fr 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
H 22
Die Vorlesung bietet einen Überblick über den Anteil Russlands und der Sowjetunion an globalen Verknüpfungen und Prozessen von der Londoner Weltausstellung 1851 bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991. Anhand der Themenfelder Raum und Kommunikation, Herrschaft und Recht, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Religion sowie Umweltfragen werden die Geschichten Russlands und der Sowjetunion in globale Zusammenhänge gestellt. Dabei geht es auch um die Frage, welche Beiträge die Osteuropäische Geschichte zu aktuellen Debatten der Globalgeschichte und unserer Auffassung der Moderne leisten kann.
Literatur:
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: Martin.Aust@lrz.uni-muenchen.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Das östliche Europa im Zweiten Weltkrieg
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 127
Zeit:
Fr 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
wird noch bekanntgegeben
Zweifelsohne ist der Zweite Weltkrieg für das östliche Europa von einschneidender Bedeutung gewesen. Die Vorlesung thematisiert daher die ideologischen Grundlagen des Vernichtungskrieges, befasst sich mit dem Kriegsgeschehen und der deutschen Besatzungspolitik, mit dem Holocaust wie mit Verbrechen der Wehrmacht. Zur Sprache kommen werden ferner die Reaktionen der Okkupierten sowie die Rolle der mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbündeten Staaten in Ostmittel- und Südosteuropa.
Literatur:
Das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg, herausgegeben im Auftrag des Militärhistorischen Forschungsamtes Potsdam, 10 Bände, Stuttgart 1979-2008.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: toensmeyert@aol.com
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Geschichte Ungarns vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 128
Zeit:
Mo 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
WIOS 017
Die Vorlesung arbeitet die Grundzüge der Geschichte Ungarns von der Staatsgründung um 1000 bis 1989 anhand der internationalen Fachliteratur heraus. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Strukturen im politisch-rechtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, die entweder periodisch oder epochenübergreifend prägend waren. Unter dem zweiten Leitaspekt der Nachbarschaftsbeziehungen und überregionalen Verbindungslinien wird auch der gesamteuropäische Deutungsrahmen aufgezeigt.
Literatur:
Literatur wird zum Semesterbeginn bekanntgegeben.
Anmeldung:
Anmeldung nicht erforderlich
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige und aktive Teilnahme
Israel/Palästina. Die Geschichte eines Landes, von 1882 bis zur Gegenwart
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 129
Zeit:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung 29.6.-9.7.2010 von 18-20 Uhr
Beginn:
29.06.2010
Raum:
CH 33.0.87
Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten ist über 100 Jahre alt. In der Vorlesung werden die Gründe dieses Konflikts analysiert und die Rolle von Nationalismus und Kolonialismus in der „Geschichte eines Landes“ untersucht. Die zionistische Ideologie sowie die zionistische Siedlungspolitik vor der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 werden einer eingehenden Analyse unterzogen. Die „Nakba“ (die Vertreibung der Palästinenser), die Rolle des arabischen Nationalismus wie auch die Formierung einer palästinensischen Identität seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert werden intensiv diskutiert. Andere Themen der Vorlesung sind Ethnizität und Gender, Staat und Religion, Menschenrechte, Krieg und Gesellschaft sowie die erste Intifada. Im Kurs sollen auch Dokumentarfilme sowie Spielfilme zum besseren Verständnis gezeigt werden.
Literatur:
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: cp59@leicester.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.2 - 05.2 - 06.1 - 07.2 - 14.2 - 15.1 - 15.2 - 18.2
GES-M
03.3 - 06.2 - 10.2
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Hauptseminar
in Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte
Kriegsopfer und Sozialpolitik nach den Weltkriegen (mit besonderer Berücksichtigung Osteuropas)
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 140a
Zeit:
Mi 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
H 37 (Vorklinikum Biologie) (Raumänderung!)
Schon 1983 beschrieb Michael Geyer in einem wegweisenden Aufsatz die Kriegsopferversorgung als "Vorboten des Wohlfahrtsstaates". Nach dem Ersten Weltkrieg waren sowohl die alten Staaten Westeuropas als auch die neu- und wieder entstehenden Staaten Osteuropas mit dem Problem der Versorgung der Kriegswitwen, -waisen und invaliden konfrontiert. Die Lösungsansätze folgten der Logik moderner Sozialpolitik und legten damit Grundlagen für die weitere Entwicklung. Dieser Zusammenhang ist mittlerweile nicht nur für die west-, sondern –in neuen Forschungen – auf für die osteuropäischen Länder gut nachvollziehbar. Wir werden uns in dem Seminar eingehend mit dem aufgezeigten Zusammenhang befassen und dabei den Blick auch auf die weitere Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg werfen.
Literatur:
Geyer, Michael, Ein Vorbote des Wohlfahrtsstaates. Die Kriegsopferversorgung in Frankreich, Deutschland und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg, in: GG 9, 1983, 230–277.
Cohen, Deborah, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914–1939. Berkeley/Los Angeles/London 1968.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per Email an: Natali.Stegmann@geschichte.uni-r.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Aktueller Hinweis: Die Veranstaltung entfällt.
Umweltgeschichte Osteuropas in der Neuzeit
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Eine Umweltgeschichte Russlands und der Sowjetunion ist gerade erst im Entstehen begriffen. Das Hauptseminar wird zentrale Themen dieser Umweltgeschichte beleuchten: Raumvorstellungen und Raumbeherrschung, Infrastrukturen und Großbauten, Technikkult, Professionen wie Ingenieure und Geologen, Umweltverschmutzung und Naturkatastrophen, ökologische Bewegungen und schließlich Rußland im Angesicht des gegenwärtigen Klimawandels.
Literatur:
Joachim Radkau, Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, München 2000.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: Martin.Aust@lrz.uni-muenchen.de
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Migration in und aus Südosteuropa im 19. und 20. Jh.: Arbeitsmigration, Zwangsmigration, Transnationalismus
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 139
Zeit:
Mi 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
28.4.2010 (Terminänderung!)
Raum:
W 116
Südosteuropa gehört zu den Regionen Europas mit der größten Migrationsintensität – und zwar in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart. Die Beschäftigung mit dem komplexen gesellschaftlichen Phänomen Migration eröffnet daher nicht nur wichtige Perspektiven für das Verständnis der Entwicklung Südosteuropas, sondern kann auch dazu dienen, zentrale Konzepte der Migrationsforschung am Beispiel dieser Region zu diskutieren.
In diesem Hauptseminar sollen die wichtigen Migrationsbewegungen aus und in Südosteuropa in den letzten beiden Jahrhunderten sowie ihre vielfältigen Folgen diskutiert werden. U.a. geht es dabei um:
- Traditionelle saisonale Arbeitsmigration
- Amerikaauswanderung vor dem Ersten Weltkrieg
- Verschiedene Formen der Zwangsmigration
- „Gastarbeiter“-Migration nach dem Zweiten Weltkrieg
- Emigration nach dem Ende des Sozialismus
- Immigration nach Südosteuropa
- Transnationale Netzwerke
Literatur:
Alle relevanten Seminarunterlagen und -texte werden rechtzeitig im G.R.I.P.S. zur Verfügung gestellt.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: rosemarie.scheid@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
Präsentation, aktive Mitarbeit, Seminararbeit
Der Zweite Weltkrieg und die Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Geschichte und Erinnerung
Veranstaltungstyp:
Hauptseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 140
Zeit:
30.4., 14.5., 11.6., 2.7. jeweils 10-17
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
30.4.2010
Raum: (erneute Raumänderung!)
30.04.2010: H 15;
14.05.2010: WIOS 017;
11.06.2010: PT 1.0.6 (bis 12 Uhr); H 17 (bis 16 Uhr);
02.07.2010: WIOS 017
Obligatorische Veranstaltung für TeilnehmerInnen der Studienexkursion nach Bosnien-Herzegowina.
Als Anfang der 1990er Jahre Jugoslawien in Kriegen zerfiel, konnte man in den Medien, in politischen und wissenschaftlichen Publikationen von einem „Zuviel“ an Geschichte auf dem Balkan lesen. Von unterdrückten und eingefrorenen Erinnerungen insbesondere an den Zweiten Weltkrieg war die Rede; und davon, wie diese Erinnerungen in den 90er Jahren politisch manipuliert und missbraucht wurden und so die Spirale der Gewalt in den Kriegen der 90er Jahre anheizten. Im Hauptseminar soll exakt diese Schnittstelle - zwischen dem Zweiten Weltkrieg und seiner Erinnerung hin zu den Kriegen der 1990er Jahre in Jugoslawien - untersucht werden. Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Jugoslawien und der Zerfallskriege in den 1990ern werden ebenso diskutiert wie die Formen, Funktionen und Praktiken der Erinnerung an diese beiden einschneidenden Ereignisse.
Literatur:
Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall, Mannheim u.a.: B.I. Taschenbuch-Verlag 1993; Ders., Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von Erinnerungen und Mythen, in: Flacke, Monika, Hg., Mythen der Nationen: 1945 - Arena der Erinnerungen. Berlin: DHM 2004, Bd. 1, 373-426; Marie-Janine Calic, Der Krieg in Bosnien-Hercegovina: Ursachen, Konfliktstrukturen, internationale Lösungsversuche, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995; Steven L. Burg and Paul Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic conflict and international intervention, Armonk and London: Sharpe 1999; Branimir Anzulovic, Heavenly Serbia: From Myth to Genocide, New York and London: New York University Press, 1999
Anmeldung:
Anmeldung bis 1.April 2010 an: heike.karge@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
07.1 - 12.1 - 14.1
GES-M
10.1
Leistungspunkte:
10
Leistungsanforderungen:
aktive Teilnahme, Präsentation, Seminararbeit
Oberseminare
in Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte
Oberseminar für Doktorand/innen, Magistrand/innen, Master- und Staatsexamenskandidat/innen
Veranstaltungstyp:
Oberseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 146
Zeit:
Di 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
In dem Oberseminar für Doktoranden, Magister-, Master- und Bachelorkandidat/innen sollen einerseits die individuellen Arbeiten vorgestellt und diskutiert werden. Dabei geht es auch um die Erörterung praktischer Probleme auf dem nicht immer einfachen Weg zu einer größeren wissenschaftlichen Arbeit. Andererseits werden auf Basis der gemeinsamen Lektüre einschlägiger Texte neue geschichtswissenschaftliche Ansätze aus dem Bereich der Transfer- und Verflechtungsgeschichte sowie der transnationalen Geschichte diskutiert.
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Die Weltkriege im östlichen Europa
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 172
Zeit:
Di 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PT 3.3.50
Dieses Proseminar befaßt sich mit der Geschichte der Länder Osteuropas im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Blickfeld stehen dabei Russland bzw. die Sowjetunion, Polen, die Ukraine und die Tschechoslowakie. Anhand ausgewählter Forschungsfelder näheren wir uns dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und üben dabei auch Methoden wissenschaftlichen Arbeitens ein.
Literatur:
Beyrau, Dietrich, Schlachtfeld der Diktatoren. Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin. Göttingen 2000.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per Email an: Natali.Stegmann@geschichte.uni-r.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Das besetzte Polen
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 172a
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
CH 13.0.82 (Raumänderung!)
Für das kulturelle Gedächtnis der polnischen Bevölkerung ist die deutsche Besatzungsherrschaft bis heute die zentrale Kriegserfahrung. Das Proseminar wird entsprechend in die Geschichte Polens im Zweiten Weltkrieg einführen und dabei Aspekte wie die Besatzungsherrschaft und ihre Akteure, die Ingangsetzung des Holocaust sowie den Alltag der Okkupierten einschließlich der Auswirkungen von Kooperation und Widerstand thematisieren. Zu unterscheiden sein wird dabei zwischen jenen westpolnischen Gebieten, die dem Deutschen Reich einverleibt wurden, dem Generalgouvernement sowie dem zunächst von der Sowjetunion bis 1941 annektierten, dann deutsch besetzten Ostpolen.
Literatur:
Deutsch-polnische Beziehungen 1939 – 1945 – 1949. Eine Einführung, hrsg. v. W³odzimierz Borodziej und Klaus Ziemer, Osnabrück 2000.
Szarota, Tomasz: Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten War-schau, Paderborn 1985.
Broszat, Martin: Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961.
Anmeldung:
Anmeldung bitte unter: toensmeyert@aol.com
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
„Faschismus“ in Deutschland, Südeuropa und auf dem Balkan - Faschistische und faschistoide Bewegungen und autoritäre Staatsformen im Vergleich, 1919-1945
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 173
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
Schwerpunkt des Seminars wird der Vergleich sein. Vom italienischen und deutschen Fall ausgehend werden vor allem südosteuropäische Faschismen sowie autoritäre Bewegungen und Regime diskutiert, vorgestellt und kontextualisiert. Zum einen soll das Seminar versuchen, die Entwicklungswege, Ideologien und Bedingungen der Bewegungen und Staatsformen nachzuvollziehen. Zum anderen sollen Typologien erarbeitet werden, die uns ermöglichen die Zwischenkriegszeit überblickend zu verstehen. Ferner sollen die einzelnen Ideologien und Bewegungen in Bezug auf ihr Verhältnis zum Holocaust/genozidären Programm, zur Moderne, zu Imperium/Expansion, Krieg, Frauen und Kirche exemplarisch diskutiert werden. Neben den Grundzügen vergleichender Geschichte sollen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden.
Literatur:
Altrichter, Helmut u. Walther L. Bernecker: Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Stuttgart 2004; Payne, Stanley G.: A History of Fascism, 1914-1945. Madison 2001; Wippermann, Wolfgang: Europäischer Faschismus im Vergleich (1922-1982). Frankfurt a. M. 1983; Ursprung, Daniel: „Faschismus in Ostmittel- und Südosteuropa - Theorien, Ansätze, Fragestellungen". in: Mariana Hausleitner (Hg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. München 2006, S. 9-52; Griffin, Roger: The Nature of Fascism. London & New York 1993.
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Klausur, Kurzreferat und Hausarbeit
Geschichte der frühen Republik Türkei – Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 174
Zeit:
Do 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ALFI 017
Der Übergang vom dynastischen und multiethnischen Osmanischen Reich zu einem modernen Nationalstaat war ein schwieriger. Ja, die moderne Republik Türkei wurde im Krieg – gegen Griechenland und die Alliierten – geboren und im Frieden von Lausanne (1923) „getauft“. Danach setzte eine beeindruckende Reformtätigkeit ein. Und wie sah dann die junge Republik Türkei aus als ihr Gründer Kemal Atatürk 1938 starb? Welche Fundamente wurden für ihre weitere Entwicklung gelegt? Atatürks Regime wird oft als „Erziehungsdiktatur“ klassifiziert. In wie fern diese Bezeichnung gerechtfertigt ist, wird hier u.a. diskutiert werden müssen. Das Seminar versteht sich als Einführung in die Geschichte eines südosteuropäischen Landes und will somit auch eine Annäherung an die Geschichte von Raum und Zeit ermöglichen. Ferner sollen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden.
Literatur:
Kreiser, Klaus u. Christoph K. Neumann: Kleine Geschichte der Türkei. Stuttgart 2003; Kasaba, Resat (Hg.): The Cambridge History of Turkey - Volume 4: Turkey in the Modern World. Cambridge 2008; Kreiser, Klaus: Atatürk - Eine Biographie. München 2008; Ahmad, Feroz: Geschichte der Türkei. Essen 2005.
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Klausur, Kurzreferat und Hausarbeit
Wissenschaftliche Arbeitstechniken; Methoden der Geschichts- und Kulturwissenschaft; Präsentationstechniken
Veranstaltungstyp:
Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 175
Zeit:
Mo 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
ALFI 017
Das Proseminar richtet sich in erster Linie an Studienanfänger sowie Studierende der ersten Semester und bietet einen ersten Einblick in die Methoden und Hilfsmittel des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Neben der Vermittlung von methodischen Kenntnissen bietet das Proseminar vielfältige Möglichkeiten zur forschungspraktischen Anwendung zentraler Arbeits- und Präsentationstechniken (Bsp. Recherche/Archivbesuch/Quellenarbeit). Das Proseminar führt andererseits in wichtige geschichts- und kulturwissenschaftliche Theorien ein und soll Studierende zur Reflexion über die Grundlagen des eigenen Fachs anregen. Wir werden uns dabei sowohl mit zentralen Autoren der Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie mit dem speziellen Erkenntnissinteresse ausgewählter Teildisziplinen (wie bspw. Sozial-, Kultur-, Alltags-, Geschlechter-Geschichte, historische Anthropologie) auseinandersetzen. Um gleichzeitig eine erste Einführung in die theoretischen Besonderheiten der Südosteuropa-Forschung zu bieten, werden wir uns mit historischen Raumvorstellungen von Südost-, Mittel und Osteuropa befassen.
Reader:
Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Literatur zur Einführung:
Nils Freytag, Wolfgang Piereth: Kursbuch Geschichte. Paderborn, München und Wien 2006. Ute Daniel: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt/Main 2001. Ernst Opgenoorth: Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Paderborn 1997. Harald Roth (Hg.): Studienhandbuch Östliches Europa. Band 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas.
Anmeldung:
Bitte bis zum 05.04.2010 an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de und tegeler@suedost-institut.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle- Beteiligung, 10 min. Referat mit Handout)
- Sprachklausur (Semestermitte)
- Abschlussklausur
- 5-seitiger Essay (inklusive 3-seitige Bibliographie/Abstract)
History of Children and Childhood in Twentieth Century: Eastern and Western Perspectives.
Veranstaltungstyp:
Proseminar (in English)
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 176
Zeit:
Di 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
ALFI 017
Tutorium: An additional tutorial will be offered.
In this seminar students will gain a practical insight into the Anglo-American style of undergraduate seminars. The course will be taught in English and will train students in reading English texts, giving an oral presentation in English and in writing both a written exam and a final essay in English. Thematically we will deal with the history of of children and childhood in Eastern-, Southeastern-, and Western Europe. We will learn how children and childhood as objects of historical investigation have in recent years turned into a prominent topic of twentieth century history research, in as far as their study exposed their significant contribution to our knowledge of social history. Throughout modern history children always had a great societal value which made their well-being into an object of public undertaking. They were meant to be cared for, to be kept clean, acurately dressed, nutriously fed, well educated and socially integrated. As political crisis, wars and genocides extensively shaped the twentieth century, we will study how these historical moments left far-reaching traces on children. The seminar will furthermore examine how class, gender, race and ethnicity have influenced the life of children and their families and how they have affected the notion of childhood throughout the twentieth century.
Reader:
A complete reader will be made available online at (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php).
Introductory Literature: Philippe Ariés: Centuries of Childhood: a social history of family life. London 1973. Sabine Hering, Wolfgang Schröer (Ed.): Sorge um die Kinder. Beiträge zur Geschichte von Kindheit, Kindergarten und Kinderfürsorge, Weinheim 2008. Lloyd DeMause: The History of Childhood. New York 1974. Catriona Kelly: Children’s World. Growing up in Russia. Oxford 2007. Slobodan Naumovic, Miroslav Jovanovic (Ed.): Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing up in the 19th and 20th Century. Münster 2004.
Hinweise:
The entire seminar will be held in English. (including presentations/ essays).
Anmeldung:
Registration until 5th of April 2010 via email to friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de or via https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- active and continuous participation (including Moodle-participation, 10 min. presentation)
- obligatory language exam
- final written exam
- final essay (10-15 pages)
Die erzählte Grenze: lebensgeschichtliche Erinnerungen und Erinnerungsorte im bayerisch-böhmischen Grenzraum.
Veranstaltungstyp:
Proseminar mit Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 177
Zeit:
Mi 8-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich (mit einer Blockveranstaltung in Exkursionsform)
Beginn:
21.4.2010
Raum:
ALFI 017
Tutorium: Ein begleitendes, aber freiwilliges Tutorium wird angeboten.
Während der Eiserne Vorhang in erster Linie als Hindernis für den Transfer von Menschen, Ideen und physischen Gütern betrachtet wird, weckt die Metapher der Grenze auch gleichzeitig Vorstellungen von grenzüberschreitender Interaktion und Kommunikation. Die Vielschichtigkeit des individuellen und kollektiven Gedächtnisses in Bezug auf die Grenze, deren Charakter im 20. Jahrhundert mehrfache tiefgreifende Veränderungen durchlief, ist Gegenstand dieses Proseminars. Im Sinne einer mikrohistorischen Studie werden wir uns mit der lokalen Erinnerung an den Eisernen Vorhang im bayerisch-böhmischen Grenzraum beschäftigen. Wir werden uns dabei sowohl mit der mündlichen Repräsentation der Grenze in Lebensgeschichten, als auch mit ihrer visuellen Präsentation an ausgesuchten Erinnerungsorten auseinandersetzen. Mit Hilfe von biographischen Interviews mit Menschen aus der Region, deren alltägliches Leben von der Präsenz der Grenze geprägt war, möchten wir individuelle und biographische Grenz-Erfahrungen aufspüren. Es ist zu vermuten, dass der Eiserne Vorhang als physische Grenze auf beiden Seiten der bayerisch-böhmischen Grenze zum aktiven Widerstand gegen die fortschreitende Isolierung der – an den Eisernen Vorhang grenzenden - Regionen provozierte. Als Vorbereitung auf die eigenständig durchzuführenden Interviews wird das Seminar vielfältige Möglichkeiten bieten, methodologische und praktische Grundlagen der lebensgeschichtlichen Interviewführung zu erwerben. Die erlernten Interviewtechniken sowie theoretische Kenntnisse über die historische Funktion „erinnerter Orte“ werden wir dann im Rahmen einer zweitägigen Exkursion ins bayerisch-böhmische Grenzgebiet forschungspraktisch anwenden.
Reader:
Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Einführende Literatur:
Roswitha Breckner, Devorah Kalekin-Fishman und Ingrid Miethe: Biographies and the division of Europe: experience, action, and change on the 'Eastern side'. Opladen 2000. Katharina Eisch: Grenze. Eine Ethnographie des bayerisch-böhmischen Grenzraums. München 1996. Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinkke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg 2003. Robin Humphrey: Biographical research in Eastern Europe. Altered lives and broken biographies. Aldershot 2003. Patrick Major und Rana Mitter: Across the Blocs. Cold War Cultural and Social History. London 2004. Ulrike H. Meinhof: Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe. Ashgate 2002. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1998.
Hinweise:
- Das Seminar ist interdisziplinär.
- Gute englische Sprachkenntnisse sind erforderlich, tschechische Sprachkenntnisse nicht erforderlich, aber sehr willkommen.
Anmeldung:
Ab sofort und bis zum 05.04.2010 an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de und veronika.hofinger@web.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
03.1 - 05.1
GES-M
03.1 - 06.1
Leistungspunkte:
7
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle-Beteiligung, 10 min. Referat mit Handout und 10 min. Diskussionsleitung)
- Sprachklausur (Semestermitte)
- Abschlussklausur: (Filmanalyse)
- Durchführung eines eigenen Interviews (inkl. Transkription und Entwicklung einer 2-seitigen Forschungsthese)
Übungen
in Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte
Sites of Everyday Life in Socialist Czechoslovakia
Veranstaltungstyp:
Übung - Projektübung in englischer Sprache
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 207
Zeit:
24. bis 29. Mai 2010 (Blockveranstaltung in Prag an der Karlsuniversität)
Dauer:
Turnus:
Beginn:
Raum:
Die Verstaltung wird gemeinsam mit dem Kollegen Michal Pullmann von der Karlsuniversität in Prag durchgeführt.
Block course in Prague from 25.-28. May 2010, held by Michal Pullmann (Carls-University Prague) and Natali Stegmann (Universität Regensburg) in the framework of Erasmus-Programme (universities partnership)
Throughout four days of intensive work we will study sites of everyday life in socialist Czechoslovakia with students from Prague and Regensburg. The course will rather focus on the question, how people lived in socialism, than discussing problems of political systems. During the morning sessions we start with studying texts on different fields of everyday organisation and the functioning of socialist societies from a social and cultural historical perspective. In the afternoons we will tour the city and the neighbourhood, visiting certain points of interest, telling stories about the lives and faiths of the citizens of the former socialist Czechoslovak state. This will be workplaces, living areas, and places of recreation, monuments or meeting places. Each student will be asked to give a short presentation about one of these places or about certain historical phenomena. Access to the course is limited to 12 students from Regensburg and 12 from Prague (additionally 6 from Deutsch-Tschechische Studien in their fourth semester studying in Prague). For students coming from Regensburg to participate in the course in Prague we have applied for funding of their travel expenses.
Literatur:
Alexei Yurchak, Everythink Was Forever, Untill It Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton 2005.
Anmeldung:
Students from Prague and from Deutsch-Tschechische Studien should contact: Michal.Pullmann@ff.cuni.cz
Students from Regensburg should contact: Natali.Stegmann@geschichte.uni-regensburg.de.
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2 - 14.3 - 15.5
GES-M
10.3 - 05.4 - 07.4
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
aktive Teilnahme, ausgearbeitetes Referat
Die Türkei als europäisches und südosteuropäisches Land? Historische Standortbestimmungen und -diskussionen
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 208
Zeit:
Mi 8-10 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 2.0.9
In den vergangenen Jahren hat durch den EU-Beitrittswunsch der Republik Türkei die schon Jahrhunderte währende Frage nach der Europäizität der Türkei eine neue Brisanz bekommen. Absolute Antworten sind hier zu Felde geführt worden (wie zum Beispiel, die Türkei sei einfach ein asiatisches Land). Welche Antworten kann oder muss die Geschichte anbieten? Die Übung versucht sich diesen Antworten über drei Zugänge zu nähern: die Geschichte der Türkei mit Schwerpunkt auf raumspezifische und soziokulturelle Aspekte; eine Feinanalyse der rezenten Diskussionen sowie eine überblickende Historisierung der Debatten. Letzteres bietet sich an – denn was bedeutet es für die Debatte wenn sie scheinbar schon seit Jahrhunderten geführt wird? In der Übung werden Texte diskutiert, die sowohl aus der Debatte selbst stammen als auch Quellen und historiographische Texte, die uns einen historischen Hintergrund erschließen sollen.
Literatur:
Carnevale, R., Ihrig, S.; Weiß, C.: Europa am Bosporus (er-)finden? Die Diskussion um den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union in den britischen, deutschen, französischen und italienischen Zeitungen. Eine Presseanalyse. Frankfurt a. M. 2005; Walter, Jochen: Die Türkei - 'Das Ding auf der Schwelle'. (De-)Konstruktionen der Grenzen Europas. Wiesbaden 2008; Ihrig, Stefan: Talking Turkey, talking Europe - Turkey’s place in the common quest for defining Europe between imagining EU-Europe, the Orient and the Balkans. Insight Turkey 3/10 (Ankara, 2006), 28-36; Leggewie, Claus (ed.): Die Türkei und Europa - Die Positionen. Frankfurt a. M. 2004.
Hinweise:
Kenntnisse des Türkischen sind nicht erforderlich.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Thesenpapier und Kurzreferat (Diskussionsbeitrag).
Aktuelle Mitteilung: Zeitänderung: Die Übung wird Mi 8-10 stattfinden. Anmeldungen sind weiterhin möglich!
Südosteuropa zwischen Hitler und Mussolini - Visionen, Strategien und Herrschaft
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 209
Zeit:
Do 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ALFI 017
Welche Rolle spielte Südosteuropa für die Nationalsozialisten und die Faschisten? Und was bedeuteten die Pläne und die Besatzung der Region für die Region? Der italienische Faschismus begann sich bereits früh für Südosteuropa zu interessieren; Hitler betonte lange Zeit und oft Deutschlands Desinteresse. Die Übung wird sich der nationalsozialistischen und faschistischen Imagination in Bezug auf Südosteuropa sowie der späteren Besetzung und Besatzung nähern und damit die Region in die gesamteuropäische Perspektive einordnen. Wir werden uns sowohl mit Primärtexten, historiographischen Abhandlungen als auch mit anderen, literarischen Umsetzungen beschäftigen. Indem wir uns durch das Dickicht der Faschismusforschung eine Bresche schlagen, soll sowohl die Geschichtsschreibung als auch die Quellenlage erkundet werden.
Literatur:
Kallis, Aristotle A.: Fascist Ideology - Territory and Expansionism in Italy and Germany, 1922-1945. London 2000; Mazower, Mark: Hitler's Empire - Nazi Rule in Occupied Europe. London 2008; Rodogno, Davide: Fascism's European Empire - Italian Occupation During the Second World War. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006; Louis de Bernières: Corellis Mandoline. Frankfurt 1998 [Roman; „leichte“ Einstiegslektüre].
Hinweise:
Lesekenntnisse des Englischen sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 1. April unter si255@cam.ac.uk
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.1 - 07.1 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Aktive Teilnahme, Bibliographie und Kurzreferat
Studienexkursion: Der Zweite Weltkrieg und die Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Geschichte und Erinnerung
Veranstaltungstyp:
Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 210
Zeit:
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
22.-29.05.2010
Raum:
Im Versuch, die Gewalteskalation der 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien zu verstehen, nimmt die Exkursion die Schnittstelle zwischen Geschichte und Erinnerung des Zweiten Weltkrieges und der Kriege der 1990er Jahre in den Blick. Die Exkursion führt zu Orten, an denen sich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auf jugoslawischem Boden bzw. an den Krieg 1992-95 manifestieren und anhaltend kontrovers diskutiert werden – wie Srebrenica und Sutjeska, Omarska und Gorazde in Bosnien-Herzegowina, aber auch Jasenovac in Kroatien. Unsere 8-tägige Reise durch Bosnien-Herzegowina hält Gespräche mit WissenschaftlerInnen aus der Region, mit Vertretern von NGOs, mit Überlebenden- und Opfervereinigungen bereit, sowie auch die aktive Auseinandersetzung mit den materiellen Spuren der Erinnerung, wie Denkmälern, Gedenkstätten und Museen.
Literatur:
Hinweise:
Teilnahmevoraussetzung: Teilnahme am gleichnamigen Hauptseminar
Anmeldung:
Die Höchstteilnehmerzahl (25) ist bereits erreicht, so dass weitere Anmeldungen momentan nur noch für die Warteliste angenommen werden können. Kontakt: heike.karge@geschichte.uni-regensburg.de
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
- 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Erfolg und Tragödie - Russlands Modernisierung seit Peter dem Großen
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung zu Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 211
Zeit:
Freitag und Samstag, 9-17
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Termine:
23.-24.4. und 25.-26.6.2010
Raum:
- 23.04.2010: WIOS 309
- 24.04.2010: W 112
- 25.06.2010: WIOS 017
- 26.06.2010: W 112
Russischkenntnisse werden begrüßt, sind aber keine Voraussetzung.
Unter dem russischen Staatsoberhaupt Dmitrij Medvedev hat eine Modernisierungsdebatte in Russland begonnen, wie sie das Land schon seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Dabei handelt es sich nicht nur um eine neue wirtschaftliche Ausrichtung, sondern, so Dmitrij Medvedev, ums Überleben Russlands.
Denn das Land ist unzufrieden mit den Ergebnissen der Transformation, die mit der Perestrojka unter Michail Gorbatschov Mitte der achtziger Jahre begann und die seine Nachfolgern zum Teil fortgesetzt, zum Teil gebremst haben. Weder wirtschaftlich noch politisch ist in Russland eine nachhaltige Modernisierung gelungen. Vielleicht, weil der Kollaps des sowjetischen Imperiums nicht mehr zuließ.
Oder waren es Faktoren, die in Russland seit Jahrhunderten nicht beachtet wurden oder absichtlich ignoriert: die Weite des Landes, Russland ist das größte Land der Erde mit elf Zeitzonen; das bis heute ungeklärte Verhältnis von Staat und Privateigentum; der Missklang von Wissenschaft und Wirtschaft. Zwar gelang es der Sowjetunion den Kosmos zu erobern, doch scheiterte der Versuch einer erfolgreichen Leichtindustrie.
Lassen sich nun historische Parallelen herstellen zwischen ganz unterschiedlichen Programmen zu ganz unterschiedlichen Zeiten? Was gab den Ausschlag für tiefgreifende Reformen, und wie nachhaltig gerieten sie? Kamen diese Initiativen immer vom Staat, so wie es häufig in Russland dargestellt wird, oder hatten einige auch ihren Ursprung in der Gesellschaft?
In der Übung sollen unterschiedlichen Formen und Erfolge der Modernisierung seit Peter dem Großen diskutiert werden. Dazu gehören technische, wissenschaftliche sowie politische Reformen unter den Zaren Alexander II. und Nikolaus II. sowie unter den kommunistischen Generalsekretären bis zu Michail Gorbatschov sowie unter den russischen Präsidenten Boris Jelzin, Vladimir Putin und Dmitrij Medvedev.
Literatur:
- Bialer, Severyn (Hrsg.): Inside Gorbatchev’ Russia, Boulder 1989
- Billington, James: The Icon and the Axe, New York 1970
- Dixon, Simon: The Modernization of Russia, Cambridge 1999
- Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion, München 1998
- Hoskings, Geoffrey: Russia, People and Empire, Harvard 2001
- Kaiser, Robert: Why Gorbatchev happened, New York 1991
- Pipes, Richard: Russia under the Old Regime, London 1995
- Raeff, Marc: Plans for Political Reforms in Imperial Russia, Englewood Cliffs 1966
- Shevtsova, Lilia: Lost in Transition, Washington D.C. 2007
- Torke, Hans-Joachim: Lexikon der Geschichte Russlands, München 1985
- Stöckl, Günther: Russische Geschichte, Stuttgart 1983
- Ulam, Adam: The Bolsheviks, Cambridge 1998
Anmeldung:
Anmeldung bitte an die email-Adresse Reinhard-Krumm@t-online.de
Modul/e:
GES-LA-M
06.2 - 06.3 - 12.2
GES-M
10.3 - 05.6 - 07.6
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Mündliches und schriftliches Referat
Kollaboration in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges. Geschichte, Nachwirken und Aufarbeitung.
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 212
Zeit:
Do 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PT 1.0.6 (1. Veranstaltung) (Raumänderung!); z.T. auch im Stadtarchiv Regensburg/Kapelle
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende (MA, LA, BA) der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte sowie der deutschen Zeitgeschichte. Kenntnisse osteuropäischer Sprachen sind nicht erforderlich.
Während des Zweiten Weltkrieges trugen mehrere Millionen ausländische Soldaten deutsche Uniformen. Auch sie gerieten an vielen Fronten in die Gefangenschaft alliierter Streitkräfte. In der Übung sollen die Hintergründe für die Indienstnahme dieser "Hilfswilligen", die Motivation für ihre Kollaboration sowie die Folgen besprochen werden. Anhand von themenbezogenen Archivalien werden quellenkritische Betrachtung, Akten- und Archivkunde, Palleographie sowie Genealogie eingeübt.
Literatur:
S.I. Drobiazko (u.a.), Inostrannye formirovanija Tret'ego rejcha, Moskva 2009; R.-D. Müller, An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" 1941-1945, Berlin 2009; J.W. Gdañski, Zapomniani ¿o³nierze Hitlera, Warszawa 2005; A. Hoffmann, Die Tragödie der "Russischen Befreiungsarmee", neue Aufl., München 2003; A. Munoz, O.V. Romanko, Hitler's White Russians, New York 2003; K.A. Zalesskij, Kto byl' kto vo vtoroj mirovoj vojne. Sojuzniki Germanii, Moskva 2003; A. Anders, Russian volunteers in Hitler's army, New York 1996.
Anmeldung:
Telefonsich 0941 507 3454, per E-Mail: smolorzr@gmx.de
oder über den Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas, Vorzimmer (PT 4.1.13), Frau Rosemarie Scheid
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Kurzreferat, abschließende Klausur
Die bayerisch-tschechoslowakische Grenze im Kalten Krieg: Besichtigung des Grenzraums zwischen Furth im Wald und Hof - Geschichte, Geographie, grenzüberschreitende Kontakte
Veranstaltungstyp:
Exkursion
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33
Zeit:
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
13.05. - 15.05.2010
Raum:
Informations- und Einführungsveranstaltung am 11.Mai 2010 (Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben)
Nahezu 45 Jahre bildete der Eiserne Vorhang an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze ein undurchdringliches Hindernis, das langfristige Folgewirkungen auf das Leben der dortigen Bevölkerung nahm. Insbesondere die Errichtung eines mehreren Kilometer breiten Sperrgebiets auf der östlichen Seite führte durch großangelegte Umsiedlungsaktionen und den Abriss ganzer Ortschaften zum Verlust zahlreicher Kulturdenkmäler und über Jahrhunderte gewachsener Strukturen. Im Zentrum der Exkursion soll daher der Versuch stehen, durch Ortsbesichtigungen die gemeinsame Geschichte des Grenzraums zu erschließen und die Folgen der Teilung zu analysieren. Gemeinsam mit tschechischen Studenten der Westböhmischen Universität Pilsen werden wir im Verlauf der 3-tägigen Exkursion Museen und Gedenkstätten beiderseits der Grenze besuchen und uns im Raum zwischen Furth im Wald und Hof auf die Suche nach Relikten des Eisernen Vorhangs begeben. Zu den Besichtigungsorten gehören unter anderem eine ehemalige Nato-Anlage auf dem Hohen Bogen bei Cham, verschiedene Denkmäler und Museen, sowie die historische Burganlage Stary Herstejn. Endpunkt der Exkursion ist die Gedenkstätte zur Geschichte der deutschen Teilung in Mödlareuth bei Hof, welche anhand originalgetreu erhaltener Sperranlagen den Aufbau des Eisernen Vorhangs zeigt.
Literatur:
Hinweise:
Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen
Anmeldung:
Anmeldung bitte bis zum 23.April 2010 unter markus.meinke@geschichte.uni-regensburg.de oder persönlich in Zimmer PT 3.1.88.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
- 05.5 - 07.5
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Kolloquium
in Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte
Forschungskolloquium "Neue Perspektiven der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte"
Veranstaltungstyp:
Kolloquium
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 217
Zeit:
Fr 14-19
Dauer:
Turnus:
monatlich
Beginn:
30.04.2010
Raum:
WIOS 017
Folgende Vorträge finden statt:
30.4.2010:
Christiane Brenner: "Zwischen Ost und West". Diskursanalytische Überlegungen zur tschechoslowakischen Volksdemokratie 1945-1948;
Luminita Gatejel: Warten, hoffen und endlich fahren. Auto und Sozialismus in der DDR, der Sowjetunion und Rumänien (1956-1980);
Wendy Lower: Biographies of Violence: Twentieth Century Ukraine, Two Germanys and Austria;
20.05.2010 um 18 Uhr:
Larry Wolff (New York)
21.05.2010:
Dubravka Stojanovic: Future Needs of Serbian Historiography;
Éva Kovács: Schwarze Körper, weiße Körper - Der koloniale Blick? "Zigeuner-Darstellungen" der Moderne;
Markus Meinke: Die Sperrmaßnahmen der DDR und der CSSR an der Landesgrenze zu Bayern, 1945 bis 1990;
16.07.2010:
Claudia Kraft: Biopolitik und Herrschaft im Staatssozialismus;
Paulina Bren: Tuzex, the Hustler, and the T-Girl: Hard Currency Shopping in socialist Czechoslovakia;
Bastian Vergnon: Die bayerische SPD und die sudetendeutschen Sozialdemokraten 1945 bis 1978
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Seminar
in Didaktik der
Geschichte
Arbeiten mit Texten im (Geschichts-)Unterricht der Grund- und Hauptschule
Veranstaltungstyp:
Seminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 230
Zeit:
Mo 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
wird noch bekanntgegeben
Das historische Lernen in Grund- und Hauptschulen arbeitet sehr viel mit Texten unterschiedlichster Art. Diese Möglichkeiten auszuloten, ist das Ziel des Seminars. Dabei werden verschiedene Zugänge zu Quellen und Darstellungen im Mittelpunkt stehen und Perspektiven auf die jeweiligen Schularten eröffnet werden.
Literatur:
Hans-Jürgen Pandel: Quelleninterpretation. Die schriftliche Quelle im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2000.
Anmeldung:
Zentraler Anmeldungstermin: 8. März 2010, 14.00 Uhr, H 4
Modul/e:
GES-LA-M
08.2 - 19.1
GES-M
Leistungspunkte:
8
Leistungsanforderungen:
Referat, schriftliche Arbeit
Die Erinnerung an den Nationalsozialismus
Veranstaltungstyp:
Seminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 231
Zeit:
Mo 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
Die Erinnerung an den Nationalsozialismus stellt ein wesentliches Thema des schulischen Lernens dar. Zudem prägt die Auseinandersetzung mit dem NS aber auch das Geschichtsbewusstsein und die Geschichtskultur in Deutschland nachhaltig. Das Seminar wird sich mit den Veränderungen in der Erinnerungskultur seit 1945 beschäftigen, zudem aber auch nach aktuellen Manifestationen forschen. Hierzu wird die Bereitschaft zur Teilnahme an kleineren Exkrusionen vorausgesetzt (z. B. Dokumentation Obersalzberg).
Literatur:
Geschichte lernen, Heft 129: Erinnerung an den Nationalsozialismus; Peter Reichel/ Peter Seitnbach/ Harald Schmid (Hrsg.): Der Nationalsozialismus - die zweite Geschichte: Überwindung, Deutung, Erinnerung, München 2009.
Anmeldung:
Anmeldung unter Email: christian.kuchler@geschichte.uni-regensburg.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Modul/e:
GES-LA-M
08.2 - 19.1
GES-M
Leistungspunkte:
8
Leistungsanforderungen:
Schriftliche Quellen im Geschichtsunterricht (Realschule, Gymnasium)
Veranstaltungstyp:
Seminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 232
Zeit:
Mi 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
Schriftliche Quellen sind die wichtigste Arbeitsgrundlage des historischen Lernens. Im Geschichtsunterricht können eine Vielzahl von Schriftquellen eingesetzt werden, deren Potential Thema des Seminars sein wird.
Literatur:
Waldemar Grosch, Schriftliche Quellen und Darstellungen, in: Hilke Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2003, S. 63-91.
Anmeldung:
Zentrale Anmeldung: 8. März, 14 Uhr, H 4.
Modul/e:
GES-LA-M
08.2 - 19.1
GES-M
Leistungspunkte:
8
Leistungsanforderungen:
Referat, schriftliche Hausarbeit
Historisches Wissen präsentieren (alle Schularten)
Veranstaltungstyp:
Seminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 233
Zeit:
Do 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
ZH 1
Die Präsentationskompetenz spielt auch in den Sachfächern eine zunehmend wichtige Rolle. Schülerinnen und Schüler sollen nicht bloß Wissen erwerben, sondern jenes auch reorganisieren und in ansprechender Weise präsentieren können. Sind Verwirklichungsformen wie das Referat schon lange usus, stehen seit einiger Zeit neue Varianten wie das Portfolio im Mittelpunkt didaktischer Diskussion. Die Teilnehmer setzen sich mit theoretischen Aspekten des Themas auseinander und planen eigene Praxiszugänge.
Literatur:
Zur Einführung: Historisches Wissen präsentieren. In: Günther-Arndt, H. (Hg.): Geschichts-Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2007, S. 205-259.
Anmeldung:
Zentrale Anmeldung für Seminare in Geschichtsdidaktik: 08. März, 14.00, H 4
Modul/e:
GES-LA-M
08.2 - 19.1
GES-M
Leistungspunkte:
8
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Referat, Hausarbeit
Aufgabenstellungen und Tests im Geschichtsunterricht der Realschulen und am Gymnasium
Veranstaltungstyp:
Seminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 234
Zeit:
Fr 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
PT 1.0.4
Geschichte soll mehr Denk- denn Paukfach sein. Hat sich das auf Aufgabenstellungen im Unterricht schon ausgewirkt oder wird vor allem Wissen abgefragt (ohne das man bei aller Kompetenzorientierung Geschichte nicht betreiben kann). Welche Vorgaben macht die moderne Didaktik? Jenen Fragen soll im Seminar nachgegangen werden. Die Studierenden erarbeiten eigene Zugänge in Referaten.
Literatur:
Zur Einführung: Adamski, P.: Schriftliche Arbeiten in der Sekundarstufe I. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1/2008, S. 36-49.
Anmeldung:
Zentrale Anmeldung für Seminare Geschichtsdidaktik: 8. März, 14.00, H 4
Modul/e:
GES-LA-M
08.2 - 19.1
GES-M
Leistungspunkte:
8
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Referat, Hausarbeit
Übungen
in Didaktik der
Geschichte
Methoden und Inhalte des historischen Lernens: Die beiden deutschen Staaten 1945-1990
Veranstaltungstyp:
Seminar - Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 236
Zeit:
Di 10-12
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
Die Zeitgeschichte nach 1945 bestitzt im Geschchtsunterricht aller Schularten eine prominente Position. Wie diese Zeitspanne methodisch und didaktisch aufgereitet werden kann und welche Quellen, Darstellungen und Medien einbezogen werden können, soll die Übung diskutieren.
Literatur:
Anmeldung:
in der ersten Sitzung
Modul/e:
GES-LA-M
09.2 - 17.2 - 17.3
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Abschlussklausur
Die Stadt als Lernort für große und kleine Kinder
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 237
Zeit:
DI 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
Urbane Räume gehören zu den zentralen Manifestationen von Geschichte. In ihnen kann man die Zeit "lesen". Die Übung will der Frage nachgehen, wie eine Stadt zum Untersuchungsgegenstand des Geschichtsunterrichts werden kann. Betrachtet wird zunächst die Stadt Regensburg, vergleichende Blicke in andere Städte können jedoch das Seminar ergänzen und abrunden. Zu denken ist in diesem Zusammenhang auch an kleinere Exkursionen zu historischen Orten.
Literatur:
Geschichte lernen Heft 106: Historische Orte; Siegfried Grillmeyer/Peter Wirtz (Hrsg.): Ortstermine. Politisches Lernen am historischen Ort. 2 Bde. Schwalbach/Ts. 2006/2008; Ulrich Mayer: Historische Orte als Lernorte. In: Ulrich Mayer/Hans-Jürgen Pandel/Gerhard Schneider (Hrsg.): Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2004, S. 389-407
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
09.2 - 17.2 - 17.3
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Grundfragen des historischen Lernens an Realschulen (Bezugsveranstaltung zum studienbegleitenden Praktikum)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 238
Zeit:
MI 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
Die Studierenden sollen ihre Erfahrungen aus dem studienbegleitenden Praktikum vertiefen und zusätzliche geschichtsdidaktische Kompetenzen erwerben. Nach einer ersten Beobachtungs- und Analysephase planen und realisieren die Studierenden Geschichtsunterricht, indem sie theoretische Vorgaben, fachdidaktische Prinzipien und methodische Umsetzungsmöglichkeiten berücksichtigen.
Literatur:
Anmeldung:
Teilnehmer des
studienbegleitenden Praktikums sind automatisch angemeldet.
Modul/e:
GES-LA-M
09.3 - 16.2
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Grundfragen historischen Lernens am Gymnasium (Bezugsveranstaltung zum studienbegleitenden Praktikum)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 239
Zeit:
Mo 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
ZH1
Die Studierenden sollen ihre geschichtsdidaktische Kompetenz in Lehr- und Lernprozessen vertiefen. Der Unterricht des Praktikumslehrers und der Studierenden ist der Ausgangspunkt der Reflexion über die Auswahl und Präsentation der Inhalte sowie über die Ziele des Geschichtsunterrichts. Nach einer ersten Beobachtungs- und Analysephase planen und realisieren die Studierenden Geschichtsunterricht, indem sie theoretische Vorgaben, fachdidaktische Prinzipien und methodische Umsetzungsmöglichkeiten berücksichtigen.
Literatur:
von REEKEN, D.: Historisches Lernen im Sachunterricht. Eine Einführung mit Tipps für den Unterricht, Hohengehren 2004; SAUER, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, 7. akt. u. erw. Aufl., Seelze-Velber 2006
Anmeldung:
Teilnehmer des studienbegleitenden Praktikums sind automatisch angemeldet.
Modul/e:
GES-LA-M
09.3 - 16.2
GES-M
Leistungspunkte:
6
Leistungsanforderungen:
Erfolgreiche Teilnahme am Praktikum, schriftliche Ausarbeitung einer Unterrichtsstunde
Beratung zur Unterrichtsvorbereitung (Tutorium für die Teilnehmer am studienbegleitenden Praktikum)
Veranstaltungstyp:
Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 240
Zeit:
Mo 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
26.04.2010
Raum:
ZH 1
Teilnehmer der studienbegleitenden Praktika bekommen hier Gelegenheit, für Ihre zu haltenden Stunden intensivere Beratung zu erhalten als dies in der Begleitveranstaltung möglich ist. Grundkonzepte werden in Bezug auf Ihre didaktische Zielsetzung, reflektierte Quellen- und Mediennutzung etc. diskutiert.
Literatur:
Anmeldung:
nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Vorbereitungskurs schriftliches Staatsexamen
Veranstaltungstyp:
Übung Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 241
Zeit:
Di 14-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
H 21
Die Veranstaltung bietet Möglichkeiten, sich mit examensrelevanten Fragestellungen auseinanderzusetzen. Es werden Aufgabenstellungen besprochen, Tipps gegeben. In Kurzreferaten sollen die Studierenden schließlich Lösungsvorschläge diskutieren.
Literatur:
SAUER, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, 7. akt. u. erw. Aufl., Seelze-Velber 2006
Hinweise:
Die Veranstaltung richtet sich an alle Lehramts-Examenskandidaten, die ein schriftliches Examen abzulegen haben.
Anmeldung:
nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Historisches Lernen an der Hauptschule - vom Lehrplan zur Stunde
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 242
Zeit:
Fr 12-14
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
ZH 1
In der Übung werden grundlegende Aspekte für den Geschichtsunterricht an der Hauptschule, der ja im Rahmen des Fächerverbundes GSE realisiert wird, behandelt. Nach der theoretischen Einführung werden Stundenkonzepte vorgestellt und diskutiert.
Literatur:
SAUER, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, 7. akt. u. erw. Aufl., Seelze-Velber 2006
Anmeldung:
nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
09.2 - 17.2 - 17.3
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Referat, Ausarbeitung
Theoretische Überlegungen zum Geschichtsunterricht in der Grundschule und
unterrichtspraktische Durchführung
Veranstaltungstyp:
- Übung Fachdidaktik
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 243
Zeit:
Mo 16-18
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PHY 9.1.10 (Raumänderung!)
Das Seminar findet evtl. teilweise als Blockveranstaltung statt (in Absprache mit den Teilnehmern)
In der Übung werden zunächst theoretische Aspekte zum "Historischen Lernen"
in der Grundschule erörtert. Nach einem kurzen "Abtauchen" in den Lehrplan
wird gemeinsam eine Unterrichtssequenz entwickelt, eine Unterrichtseinheit
herausgegriffen, "unterrichtsreif" erarbeitet und in einer Klasse erprobt.
Literatur:
Waltraud Schreiber, Erste Begegnungen mit Geschichte Grundlagen historischen Lernens, Neuried 2. Aufl. 2004
Aktuelle Hinweise:
Am 26.4.2010 fällt die Veranstaltung aus. Eine Teilnahme ist ab dem 3.5.2010 noch möglich. Rückfragen an: margareta.turk@t-online.de
Anmeldung:
nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
09.2 - 17.2 - 17.3
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
aktive Mitarbeit, Ausarbeitung
Grundkurs
in Didaktik der
Geschichte
Hier kann auch der sog. 1. LPO-Schein für das Studium des Lehramts Grundschule, Hauptschule oder Realschule nach der alten Studienordnung erworben werden, für den bisher ein Proseminar vorgesehen war.
Einführung in die Didaktik des Geschichtsunterrichts (1. LPO-Schein für alle Schularten)
Veranstaltungstyp:
Grundkurs
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 245
Zeit:
Fr 8.30-10
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
H10
In einem knappen Überblick werden die wichtigsten geschichtsdidaktischen Aspekte für künftige Geschichtslehrer/-innen vorgestellt und diskutiert: Unterrichtsprinzipien, Methoden, Medien. Der Kurs dient als Grundlage und Voraussetzung für die weitere Auseinandersetzung in Seminaren und Übungen.
Literatur:
SAUER, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, 7. akt. u. erw. Aufl., Seelze-Velber 2006; GÜNTHER-ARNDT, H. (Hrsg.): Geschichts-Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2007
Hinweise:
Studierende, die laut alter LPO nur einen (!) "Pflichtschein" erwerben müssen (z. B. LA Gym oder Did.fach), können diesen nicht im Grundkurs erlangen. Hier sollte ein Seminar belegt werden. Als Fundament für das Seminar/Examen - zusätzlich zum Seminar - ist der Kurs dennoch geeignet.
Anmeldung:
nicht nötig
Modul/e:
GES-LA-M
08.1 - 09.1 - 16.1 - 17.1 - 18.1
GES-M
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
Klausur
Praktika
in Didaktik der
Geschichte
Studienbegleitendes Praktikum an Realschulen
Veranstaltungstyp:
Praktikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 247
Zeit:
Mi 8-12
Dauer:
4 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
Räume der jeweiligen Praktikumsschulen
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
09.3 - 16.2
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Studienbegleitendes Praktikum an Gymnasien
Veranstaltungstyp:
Praktikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 248
Zeit:
Mi 8-12
Dauer:
4 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
Räume der jeweiligen Praktikumsschulen
Literatur:
Anmeldung:
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 147
Zeit:
Mi 12.00-14.15
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Das Propädeutikum, das verpflichtend im ersten Semester parallel zum ersten Proseminar belegt werden muss, dient der Einführung in die allgemeinen, teilfachübergreifenden Grundlagen und in die wissenschaftliche Methodik der Geschichte. Neben den allgemeinen Rahmenbedingungen des Studiums sollen dabei vor allem Kenntnisse über Hilfsmittel und Werkzeuge des Historikers, der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und Quellen und die richtige Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten vermittelt und eingeübt werden.
Literatur:
Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften, Stuttgart 17. Aufl. 2007; Freytag, Nils / Piereth, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, Paderborn u.a. 3. Aufl. 2008.
Hinweise:
Der Besuch eines Propädeutikums parallel zum ersten Geschichtsproseminar ist für alle Erstsemester verpflichtend!
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr). Höchstteilnehmerzahl: 20.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, Arbeitsaufträge, Klausur.
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 148
Zeit:
Di 17-20
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
CH 33.1.89
Das Geschichts-Propädeutikum, das in vielen Parallelkursen angeboten wird, ist für alle Neuanfänger im Geschichtsstudium ab Wintersemester 2008/2009 als Begleitveranstaltung zum ersten Proseminar verpflichtend vorgeschrieben.
Dabei sollen nach einer Einführung in die Struktur und den Verlauf des Geschichtsstudiums Hilfsmittel für den historischen Wissenserwerb und die Recherche nach Forschungsliteratur und nach den Editionen historischer Quellen vorgestellt werden. Weitere Themen des Propädeutikums stellen der kritische Umgang mit den Quellen, ebenso wie die allgemeine Organisation wissenschaftlichen Arbeitens und eine Einführung in ausgewählte historische Hilfswissenschaften dar. Darüber hinaus soll auch auf methodische Probleme eingegangen werden, die sich bei der Beschäftigung mit der Geschichte ergeben.
Der Besuch eines Propädeutikums parallel zum ersten Geschichtsproseminar ist verpflichtend!
Literatur:
Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, 33), Stuttgart 17. Aufl. 2007; Freytag, Nils/Piereth, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten (UTB, Bd. 2569), Paderborn/München/Wien/Zürich 3. Aufl. 2008.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 149
Zeit:
Do 17-20
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
22.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Das Geschichts-Propädeutikum, das in vielen Parallelkursen angeboten wird, ist für alle Neuanfänger im Geschichtsstudium ab Wintersemester 2008/2009 als Begleitveranstaltung zum ersten Proseminar verpflichtend vorgeschrieben.
Dabei sollen nach einer Einführung in die Struktur und den Verlauf des Geschichtsstudiums Hilfsmittel für den historischen Wissenserwerb und die Recherche nach Forschungsliteratur und nach den Editionen historischer Quellen vorgestellt werden. Weitere Themen des Propädeutikums stellen der kritische Umgang mit den Quellen, ebenso wie die allgemeine Organisation wissenschaftlichen Arbeitens und eine Einführung in ausgewählte historische Hilfswissenschaften dar. Darüber hinaus soll auch auf methodische Probleme eingegangen werden, die sich bei der Beschäftigung mit der Geschichte ergeben.
Der Besuch eines Propädeutikums parallel zum ersten Geschichtsproseminar ist verpflichtend!
Literatur:
Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, 33), Stuttgart 17. Aufl. 2007; Freytag, Nils/Piereth, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten (UTB, Bd. 2569), Paderborn/München/Wien/Zürich 3. Aufl. 2008.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 150
Zeit:
Mi 8.30-10 u. Do 15-16
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
21.4.2010
Raum:
PT 1.0.6
Das Propädeutikum soll in die Arbeitsweisen der Geschichtswissenschaft einführen, d.h. es soll gezeigt werden, wie in der Geschichtswissenschaft gearbeitet wird, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu werden in der Veranstaltung nach einer Einführung in die Rahmenbedingungen des Studiums zunächst allgemeine Hilfsmittel vorgestellt, die das Arbeiten in der Geschichtswissenschaft erleichtern und teilweise erst ermöglichen, es wird die Organisation des wissenschaftlichen Arbeitens präsentiert und eingeübt und es wird der kritische Umgang mit Quellen behandelt. Ferner wird gezeigt, welchen Dienst die Historischen Hilfswissenschaften leisten können, es werden theoretische Probleme der Geschichtswissenschaft angesprochen und auch praktische Hinweise zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit gegeben.
Literatur:
BAUMGART, Winfried: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Handbücher, Quellen, 16. Aufl., München 2006. - FREYTAG, Nils/PIERETH, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, 4. Aufl., Paderborn 2009. - BRANDT, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, Bd. 33), 17. Aufl., Stuttgart 2007.
Hinweise:
Ein Propädeutikum ist parallel zum ersten Geschichtsproseminar zu besuchen.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Höchstteilnehmerzahl: 20.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
0
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme, Anfertigung von Hausaufgaben, Klausur.
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 151
Zeit:
Mo 12-15
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
CH 33.1.93
Mit dem Besuch des ersten Proseminars in Geschichte muß auch das Propädeutikum absolviert werden. Neben einer kurzen Einführung in Studienaufbau und Hochschulorganisation ist es Hauptziel dieser Veranstaltung, den Studierenden zunächst die <handwerklichen> Grundlagen der Geschichtswissenschaft zu vermitteln. So werden u. a. wichtige Hilfsmittel vorgestellt, Grundlagen der Quellenarbeit erläutert, Hilfs- und Nachbarwissenschaften der Geschichte präsentiert oder Techniken der Literaturrecherche eingeübt.
Daneben sollen allerdings auch einige methodische Probleme, wie die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Geschichte überhaupt oder die erkenntnisbestimmenden Folgen unterschiedlicher geschichtstheoretischer Konzeptionen, thematisiert werden.
Literatur:
CORNELIßEN, Christoph (Hrsg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung. 3. Aufl., Frankfurt/Main 2004; FREYTAG, Nils / PIERETH, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten. 2. Aufl., Paderborn 2006; GOERTZ, Hans-Jürgen (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs. 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2007; IGGERS, Georg G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, Göttingen 2007.
Hinweise:
Zusätzliches Lehrangebot Lehrstuhl Prof. Luttenberger. Die Veranstaltung ist parallel zum ersten Geschichtsproseminar zu besuchen.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Anwesenheit, Mitarbeit und Klausur
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 152
Zeit:
Di 17-20 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
20.4.2010
Raum:
PHY 9.1.11
Mit dem Besuch des ersten Proseminars in Geschichte muß auch das Propädeutikum absolviert werden. Neben einer kurzen Einführung in Studienaufbau und Hochschulorganisation ist es Hauptziel dieser Veranstaltung, den Studierenden zunächst die <handwerklichen> Grundlagen der Geschichtswissenschaft zu vermitteln. So werden u. a. wichtige Hilfsmittel vorgestellt, Grundlagen der Quellenarbeit erläutert, Hilfs- und Nachbarwissenschaften der Geschichte präsentiert oder Techniken der Literaturrecherche eingeübt.
Daneben sollen allerdings auch einige methodische Probleme, wie die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Geschichte überhaupt oder die erkenntnisbestimmenden Folgen unterschiedlicher geschichtstheoretischer Konzeptionen, thematisiert werden.
Literatur:
CORNELIßEN, Christoph (Hrsg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung. 3. Aufl., Frankfurt/Main 2004; FREYTAG, Nils / PIERETH, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten. 2. Aufl., Paderborn 2006; GOERTZ, Hans-Jürgen (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs. 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2007; IGGERS, Georg G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, Göttingen 2007.
Hinweise:
Zusätzliches Lehrangebot Lehrstuhl Prof. Luttenberger. Die Veranstaltung ist parallel zum ersten Geschichtsproseminar zu besuchen.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Anwesenheit, Mitarbeit und Klausur
Propädeutikum - Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 153
Zeit:
Mi 16-18.30 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
H 45
Parallel zum Besuch des ersten Proseminars muss auch ein Propädeutikum als Basis für das Geschichtsstudium erfolgreich absolviert werden. Das Propädeutikum vermittelt neben einer Einführung in die Rahmenbedingungen des Geschichtsstudiums das nötige "Handwerkszeug" zum geschichtswissenschaftlichen Arbeiten. In der Veranstaltung werden die für die Historikerin/den Historiker grundlegenden Hilfsmittel ebenso vorgestellt und anhand praktischer Übungen vertieft, wie der kritische Umgang mit Fachliteratur und Quellen. Auch werden die sinnvolle Organisation wissenschaftlicher Arbeit und die Präsentation der erarbeiteten Erkenntnisse in Form eines Referats oder einer Hausarbeit mit den entsprechenden Formalia und Zitierrichtlinien behandelt. Ein Blick auf die Nachbardisziplinen und auf methodische Probleme der Geschichtswissenschaft rundet dieses Grundlagenseminar ab.
Literatur:
FREYTAG, Nils / PIERETH, Wolfgang, Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten. 2. Aufl. Paderborn 2006; BRANDT, Ahasver von, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, Bd. 33), Stuttgart 17. Aufl. 2007; BAUMGART, Winfried, Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Handbücher, Quellen (dtv), München 16. Aufl. 2006.
Hinweise:
Parallel zum ersten Geschichtsproseminar ist ein Propädeutikum zu besuchen! Beginn der Veranstaltung: 9.00 s.t.!
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr). Höchstteilnehmerzahl: 20.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
0
Leistungsanforderungen:
regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit, Hausaufgaben und Abschlussklausur
Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 154
Zeit:
Fr 12.00-14.15
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
23.4.2010
Raum:
ZH 2 (Raumänderung!)
Das Propädeutikum ist eine im ersten Semester parallel zum ersten Proseminar zu besuchende Veranstaltung, in der die allgemeinen, teilfachübergreifenden Grundlagen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden. Dazu gehören u. a. die Bereiche ‘allgemeine theoretische Grundlagen des Faches’, ‘Wissenserwerb und Literaturrecherche’, ‘Organisation wissenschaftlichen Arbeitens’, ‘Formen der Wissenspräsentation (Arbeitsauftrag/Referat; Seminararbeit, einschließlich Formalia/Zitierrichtlinien)’. Die Veranstaltung endet mit einer Abschlussklausur, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Geschichtsstudiums ist.
Literatur:
Freytag, N./Piereth, W.: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten, 3. Aufl. Paderborn u. a. 2008 [ND 2009] [zur Anschaffung dringend empfohlen!]; Baumgart, W.: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte, 16. korr. Aufl. München 2006.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
0
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Teilnahme, Übernahme von Arbeitsaufträgen sowie Bestehen der Abschlussklausur.
Propädeutikum: Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten
Veranstaltungstyp:
Propädeutikum
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 155
Zeit:
Mo 17-20 (Terminänderung!)
Dauer:
2 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PHY 5.1.03 (Raumänderung!)
Als obligatorische Begleitveranstaltung zum ersten besuchten Proseminar soll das Geschichte-Propädeutikum eine allgemeine, die Teilfächer der Alten, Mittelalterlichen, Neueren/Neuesten und Bayerischen Geschichte übergreifende Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten bieten. Nach einem Überblick über den Aufbau des Geschichtsstudiums an der Universität Regensburg werden die wichtigsten Hilfsmittel für den historischen Wissenserwerb, für die Recherche nach Forschungsliteratur und für die Suche nach den Editionen historischer Quellen vorgestellt. Darüber hinaus soll anhand ausgewählter Beispiele der notwendige kritische Umgang mit Quellen aufgezeigt werden. Weitere Schwerpunkte des Propädeutikums bilden neben der Organisation wissenschaftlichen Arbeitens auch die Vorstellung historischer Hilfswissenschaften, ebenso wie die Frage nach Bedeutung, Funktion und Methoden der Geschichtswissenschaft.
Literatur:
Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, Bd. 33), Stuttgart 17. Aufl. 2007; Freytag, Nils/Piereth, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten (UTB, Bd. 2569), Paderborn/München/Wien/Zürich 3. Aufl. 2008.
Hinweise:
Seit dem Wintersemester 2008/2009 ist an der Universität Regensburg für alle, die ein Studium der Geschichte beginnen, der Besuch eines Propädeutikums parallel zum ersten Geschichtsproseminar verpflichtend. Dieses Propädeutikum wird in zahlreichen Parallelkursen angeboten.
Anmeldung:
Online über RKS (13.4.2010, 17.00 Uhr bis 18.4.2010, 18.00 Uhr). Höchstteilnehmerzahl: 20.
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit, Hausaufgaben, Klausur.
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen zur beruflichen Orientierung (Blockseminar)
Veranstaltungstyp:
Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 181
Zeit:
Fr., 9-17; Sa., 9-13: 23./24.4. - 11./12.6. - 2./3.7. - 16./17.7.2010 (Terminänderung!)
Dauer:
Turnus:
Blockveranstaltung
Beginn:
Raum:
Vortragssaal ehem. Finanzamt
Schlüsselkompetenzen gewinnen in einer globalisierten Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung. Sie lassen sich in drei Kompetenzfelder unterteilen: Personale, soziale und methodische Kompetenzen. Das Institut für Geschichte veranstaltet in Kooperation mit dem „Netzwerk der Hochschuldozenten zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen“ (Berlin) ein Blockseminar zur Förderung der Berufsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung von Studierenden. In drei Blockveranstaltungen, die jeweils von Freitag bis Samstag stattfinden und von externen Referenten durchgeführt werden, sollen zentrale Schlüsselkompetenzen wie Methoden-, Sozial-, Selbst- und Kommunikationskompetenz vermittelt werden, die in immer mehr Arbeitsfeldern gefordert werden und den Einstieg in das spätere Berufsleben erleichtern.
Termine:
- M. Feuerbach; 23./24.04.10: Rhetorik, Präsentation und Konfliktmanagement. Rhetorik und Präsentation (Einführung in die Grundlagen der Rhetorik, Präsentation; Eigenaktivität u.a. Kurzvorträge zu historischen Themen mit anschließenden Videoanalysen der Körpersprache); Einführung in verschiedene Kommunikationsmodelle; Einführung in interkulturelle Kommunikationstheorie / Globales Lernen
- M. Driller; 11./12.06.10: Selbst- und Zeitmanagement, Lern- und Arbeitstechniken. Theorie des Zeitmanagements, / Selbst-, Zeitmanagement und Arbeitstechniken / Stärken,- und Kompetenzanalyse anhand verschiedener Persönlichkeitstests, / Karriereanker
- I. Winkler; 02./03.07.10 und 16./17.07.10: Führung von Teams, Gesprächen und Verhandlungen. Gesprächs- und Verhandlungsführung für Historiker / Teamarbeit und Führungskräftetraining / Konfliktmanagement / Konfliktmoderation nach Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation als ein Kommunikationsmodell / Einführung in Mediation von Konflikten
Literatur:
Anmeldung:
Ab Mi., 10.2.2010, im Sekretariat des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte (PT 3.1.45, Frau Völcker).
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte:
Leistungsanforderungen:
Die dem „Churfrten. Markt Abach gnädigt ertheilten Freyheithen“ von 1733. Quellenübung zum Marktrecht in Bayern
(Veranstaltung auch im Rahmen der EDV-Ergänzungsausbildung)
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Hilfswissenschaftliche Übung - EDV-Übung
Vorlesungsverzeichnis Nr.:
33 196
Zeit:
Mo 12-14 (Terminänderung!) (wöchentlich) u. Mo 15-17 (14-täglich)
Dauer:
3 Semesterwochenstunden
Turnus:
wöchentlich (Geschichte-Übung) u. 14-täglich (EDV-Teil)
Beginn:
19.4.2010
Raum:
PT 3.0.60 (Raumänderung!) u. CIP-Pool PT 2.0.2
Die Übung soll einen Beitrag leisten zur Edition einer handschriftlichen archivalischen Quelle aus dem 18. Jahrhundert: des Marktrechts von (Bad) Abbach, das der damalige bayerische Kurfürst Karl Albrecht 1733 den Bürgern von Abbach bestätigte. Dabei sollen auch allgemeine Kenntnisse über das Marktrecht in Bayern gewonnen werden.
Die Teilnehmer der Übung sollen also einen Teil der genannten Quelle transkribieren, ihren Inhalt nach wissenschaftlichen Kriterien erschließen und darüber hinaus die erstellte Edition für eine Publikation im Internet vorbereiten. Einen Bestandteil der Übung wird deshalb eine Einführung in die Erstellung von Web-Seiten mit HTML bilden. Grundkenntnisse in EDV und Paläographie sind hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.
Literatur:
Zur Erstellung von Web-Seiten siehe die Einführung in HTML von Stefan Münz unter der Adresse:
http://de.selfhtml.org/.
Anmeldung:
Eine Anmeldung - online über die Adresse http://anmeldung-koeglmeier.ist-im-netz.de - ist notwendig und ab sofort möglich.
Modul/e:
GES-LA-M
04.2 - 06.2 - 06.3 - 13.3
GES-M
04.2 - 11.3 - 05.1 - 07.1 - 05.2 - 07.2 - 05.3 - 07.3
Leistungspunkte:
4
Leistungsanforderungen:
regelmäßige und aktive Teilnahme, Lesen und Interpretation von archivalischen Quellen, Erstellen einer Online-Edition einer archivalischen Quelle im Rahmen einer Seminararbeit.
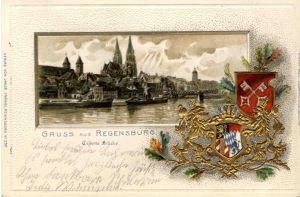 Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Projektübung
Veranstaltungstyp:
Übung - Übung Quellenkunde - Projektübung